6 Minuten
AI as the defining technology—and the distribution problem it exposes
Künstliche Intelligenz gilt weithin als die Schlüsseltechnik unserer Zeit. Fortschritte in Bereichen wie Machine Learning, großen Sprachmodellen, Automatisierung und datengetriebenen Systemen versprechen Durchbrüche in Gesundheit, Technik, Logistik und kreativen Branchen. Jenseits der rein technischen Fähigkeiten stellt sich jedoch eine politische und ökonomische Frage: Wenn KI eine bisher ungeahnte Fülle erzeugt, wie wird dieser Wohlstand verteilt?
Die Spannung zeigt sich bereits auf nationaler Ebene. Nehmen wir Australien als Beispiel: Offizielle Schätzungen beziffern die jährlichen Lebensmittelverluste auf etwa 7,6 Millionen Tonnen – rund 312 Kilogramm pro Person – während fast eine von acht Personen in Australien unter Ernährungsunsicherheit leidet, weil das Geld zum Einkauf fehlt. Dieses Paradoxon – Überfluss neben anhaltender Armut – macht die Verteilungsgrenzen des heutigen marktbasierten Wirtschaftsmodells angesichts technologischer Fülle sichtbar.
Warum KI das traditionelle ökonomische Modell infrage stellt
Die klassische Wirtschaftstheorie, wie sie etwa Lionel Robbins formulierte, versteht Ökonomie als Zuweisung knapper Mittel zur Befriedigung konkurrierender Bedürfnisse. Märkte regeln die Zuteilung knapper Ressourcen über Preise; Menschen arbeiten, um Einkommen zu erzielen und damit Güter zu kaufen. Wenn jedoch KI und Automatisierung die Grenzkosten für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen massiv senken – oder große Teile bezahlter Arbeit ersetzen – gerät die Knappheitslogik, die Preise und einkommensabhängige Lebensgrundlagen stützt, ins Wanken.
Das wirft zwei zentrale Fragen auf: Können Marktmechanismen weiter funktionieren, wenn Arbeit weniger erforderlich wird? Und falls nicht, welche politischen und institutionellen Veränderungen sind nötig, damit technologische Gewinne geteilt statt konzentriert werden?
Lehren aus der Pandemie: Geldtransfers, Grundeinkommen und praktische Experimente
Die weltweite Reaktion auf COVID-19 stellt ein pragmatisches Experiment zur Umverteilung dar, wenn die üblichen ökonomischen Kanäle versagen. Regierungen in mehr als 200 Ländern führten direkte Geldzahlungen ein; viele erhöhten Sozialleistungen oder lockerten Anspruchsprüfungen. An mehreren Orten – darunter Australien – reduzierten diese Maßnahmen Armut und Ernährungsunsicherheit merklich, obwohl die Wirtschaftstätigkeit zurückging.
Diese Erfahrung hat das Interesse an einem universellen Grundeinkommen (UBI) als politischem Instrument für den Übergang zu einer KI-dominierten Ökonomie neu belebt. Forschungsinitiativen wie das Australian Basic Income Lab (eine Kooperation von Macquarie University, University of Sydney und Australian National University) untersuchen, wie garantierte Einkommensmodelle in der Praxis funktionieren könnten.
Produktmerkmale: Wie ein modernes UBI-System aussehen könnte
- Monatliche, planbare Auszahlung an jede*r Einwohner*in, bemessen oberhalb einer Armutsgrenze.
- Automatische Indexierung an Inflation und regionale Lebenshaltungskosten.
- Nahtlose digitale Auslieferung über sichere Zahlungssysteme und Identitätsprüfung (z. B. digitale ID, Open-Banking-APIs).
- Integration mit zielgerichteten sozialen Leistungen für Wohnen, Gesundheitsversorgung und Umschulung.
- Transparente Governance durch offene Datendashboards und ergebnisorientierte Prüfungen.
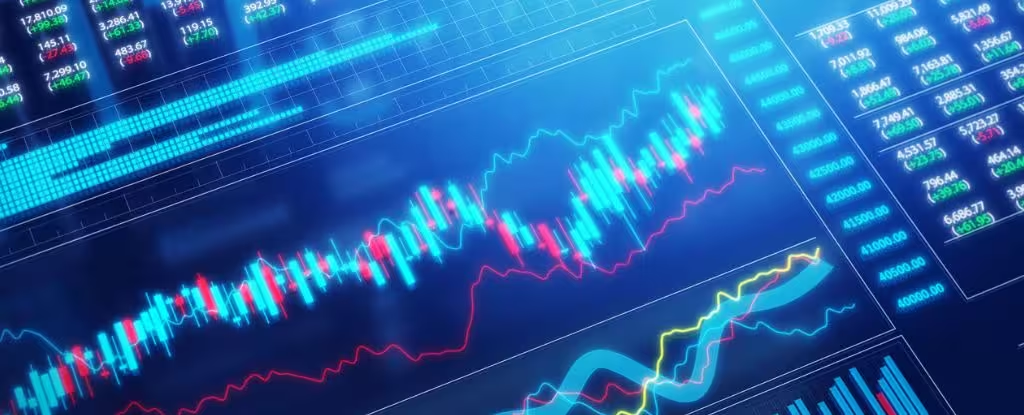
Wohlfahrt oder ein legitimer Anteil? Die Bedeutung des Framings
Nicht alle UBI-Vorschläge sind gleichwertig. Manche laufen Gefahr, lediglich als minimale Sicherungsnetze zu wirken, die die zugrundeliegenden Vermögensungleichheiten unangetastet lassen. Andere – vertreten von Wissenschaftler*innen wie Elise Klein und James Ferguson – verstehen UBI als einen "rechtmäßigen Anteil": einen öffentlichen Anspruch auf den gemeinsam durch Technologie, natürliche Ressourcen und gesellschaftliche Kooperation geschaffenen Wohlstand.
Dieses Framing setzt digitale Innovation und KI nicht nur als privates geistiges Eigentum, sondern als ein soziales Produkt, das breite Umverteilung rechtfertigt – ähnlich wie viele Gesellschaften natürliche Ressourcen als Gemeingüter behandeln.
Universal Basic Services: eine Alternative zum Geld
Ein weiterer politischer Weg führt über universelle Grundleistungen. Die provokative Idee des britischen Kommentators Aaron Bastani von einem "fully automated luxury communism" liefert Denkanstöße, die praktische Variante fokussiert jedoch auf die Vergesellschaftung zentraler Dienstleistungen: kostenlose Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentlicher Verkehr, Energie und Altenpflege. Statt Menschen Geld zu geben, damit sie Leistungen auf dem Markt einkaufen, stellen staatliche Institutionen diese Dienstleistungen direkt bereit – potenziell effizienter, wenn Märkte versagen, die Grundbedürfnisse zu erfüllen.
Vergleich: UBI vs Universal Basic Services (UBS)
| Feature | UBI | Universal Basic Services |
|---|---|---|
| Delivery | Direct cash payments | Publicly funded services |
| Flexibility | High—recipients choose spending | Lower—services are predefined |
| Administrative complexity | Moderate—requires digital pay systems | High—requires service infrastructure |
| Impact on markets | Supports private markets | Partially displaces market providers |
Vorteile, Anwendungsfälle und Bedeutung für den Markt
Vorzüge von UBI oder UBS in einer KI-getriebenen Ökonomie umfassen Armutsreduktion, Abmilderung von Nachfrageschocks und die Ermöglichung von Umschulungen für neue digitale Berufe. Für Unternehmen bedeuten planbare Einkommensströme und gestärkte Konsumnachfrage Stabilität, während universelle Dienstleistungen Fluktuation im Personal und Gesundheitskosten senken können.
Anwendungsbeispiele:
- Regionen, die von schneller Automatisierung in Produktion oder Transport betroffen sind, könnten hybride Modelle testen (teilweises UBI + gezielte Umschulungs-Gutscheine).
- Gesundheitssysteme, die durch KI-Diagnostik ergänzt werden, könnten universell zugänglich gemacht werden, um langfristige Kosten zu senken.
- Öffentliche KI-Plattformen für Verkehrsplanung und Energieoptimierung können kollektiven Nutzen stiften, wenn sie offen und demokratisch gesteuert werden.
Risiken: Technofeudalismus, Machtkonzentration und ökologische Grenzen
Optimismus angesichts möglicher Fülle muss mit politischen Realitäten abgewogen werden. Konzentrierte Unternehmensmacht – dominante Cloud-Plattformen, proprietäre KI-Stacks und Datenmonopole – könnte eine Form des "Technofeudalismus" begünstigen, in der wenige Firmen essentielle digitale Infrastruktur kontrollieren und von Nutzer*innen Renten abschöpfen. Zudem sind ökologische Grenzen zu berücksichtigen: Produktion ist nicht unbegrenzt, Nachhaltigkeit muss daher zentraler Bestandteil politischer Gestaltung sein.
Politisches Instrumentarium für eine gerechte, KI-gestützte Zukunft
Politikgestalter*innen und Tech-Verantwortliche sollten ein Bündel von Maßnahmen erwägen: garantierte Einkommen, universelle Dienste, progressive Besteuerung von Automatisierungsrenten, Daten-Dividenden sowie öffentliche Investitionen in Open-Source-KI und digitale Infrastruktur. Ebenso wichtig sind Governance-Aspekte: demokratische Aufsicht, Transparenzpflichten für KI-Systeme und arbeiterorientierte Übergangsprogramme.
Schluss: Fülle braucht aktive gesellschaftliche Gestaltung
KI und Machine Learning können enorme Produktivitätsgewinne und neue Angebote hervorbringen. Aber Technologie allein garantiert keinen geteilten Wohlstand. Das Verteilungsergebnis – ob Fülle einigen wenigen oder allen zugutekommt – hängt von bewussten politischen Entscheidungen über Geld, Wohlfahrt und Eigentum an KI-basiertem Wert ab.
Wir verfügen bereits über Wissen und Ressourcen, um viele Formen von Armut zu beenden; die Verbindung digitaler Innovation mit kluger Politik könnte das im großen Maßstab möglich machen. Die Frage für Technolog*innen, Entscheidungsträger*innen und Bürger*innen lautet somit nicht nur „Was kann KI?“, sondern auch „Wer profitiert von den Gewinnen – und nach welchen Regeln?"
Quelle: theconversation

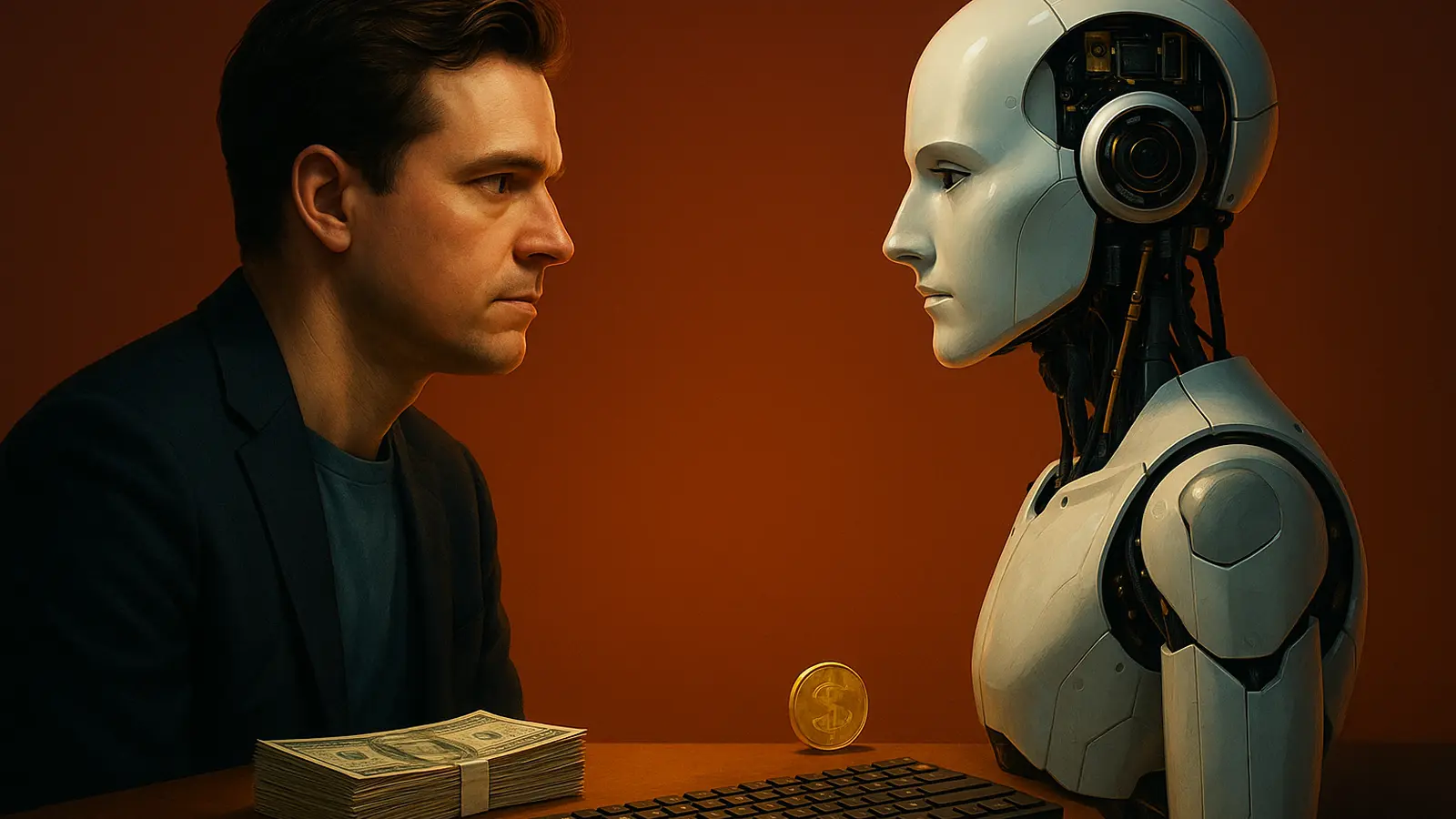
Kommentar hinterlassen