8 Minuten
Goldman Sachs sagt, die KI-Euphorie sei keine spekulative Blase – sie ist die Auftaktphase. In einem neuen Bericht argumentiert die Investmentbank, dass die heutigen KI-Ausgaben im Verhältnis zum langfristigen Potenzial der Technologie noch gering sind und erwartet, dass die Investitionen in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Diese Einschätzung umfasst Bereiche wie generative KI, maschinelles Lernen, Rechenzentren, GPUs und spezialisierte Beschleuniger.
Warum Goldman glaubt, die KI-Story ist lange nicht vorbei
Analysten bei Goldman schätzen, dass sich die heute mit KI verbundenen Investitionen in den USA auf unter 1 % des BIP belaufen. Das liegt deutlich unter den Spitzenwerten früherer Transformationswellen – Bahninfrastruktur, Elektrifizierung und das Internet erreichten in ihren Hochphasen vielfach 2–5 % des BIP. Diese Differenz interpretiert Goldman als Hinweis auf erheblichen Spielraum für weitere Kapitalallokationen und Wachstum bei KI-Investitionen.
Der Bericht nennt zwei zentrale Treiber für die optimistische Einschätzung. Erstens liefern KI-Einführungen bereits messbare Produktivitätsgewinne in etablierten Sektoren: von automatisiertem Kundensupport über Prozessoptimierung in Finanzen bis hin zu Effizienzsteigerungen in der Fertigung. Zweitens beruhen viele dieser Effekte auf großskaliger Compute-Infrastruktur – Chips, Server und Rechenzentren –, die aktuelle Ausgaben rechtfertigen und weiteren Investitionsbedarf erzeugen, wenn Unternehmen ihre Deployments ausweiten.
Historischer Kontext und volkswirtschaftliche Bedeutung
Historische Transformationszyklen zeigen, dass Infrastrukturaufbau und technologische Adoption oft Jahre benötigen, bis sich Effekte vollständig in der Volkswirtschaft abbilden. Die Messung von KI-Ausgaben als Anteil des BIP liefert eine vergleichbare Metrik: Während die Anfangsphasen nettokapitalintensiv sind, entsteht der eigentliche volkswirtschaftliche Mehrwert durch Produktivitätsgewinne und neue Geschäftsmodelle. Daher ist die aktuelle geringe Basis kein Zeichen für Überhitzung, sondern für ein frühes Stadium der Diffusion.
Branchenübergreifende Produktivitätshebel
Konkrete Anwendungsfälle reichen von automatisierter Textgenerierung und Wissensmanagement in Dienstleistungsbranchen bis zu prädiktiver Wartung in der Industrie. Generative KI kann in Marketing, Forschung & Entwicklung sowie in rechtlichen und finanziellen Workflows spürbare Zeiteinsparungen erzielen. Diese sektorübergreifenden Effekte schaffen kumulative Produktivitätssteigerungen und erhöhen die Kapitalrenditen für Unternehmen, die KI erfolgreich integrieren.
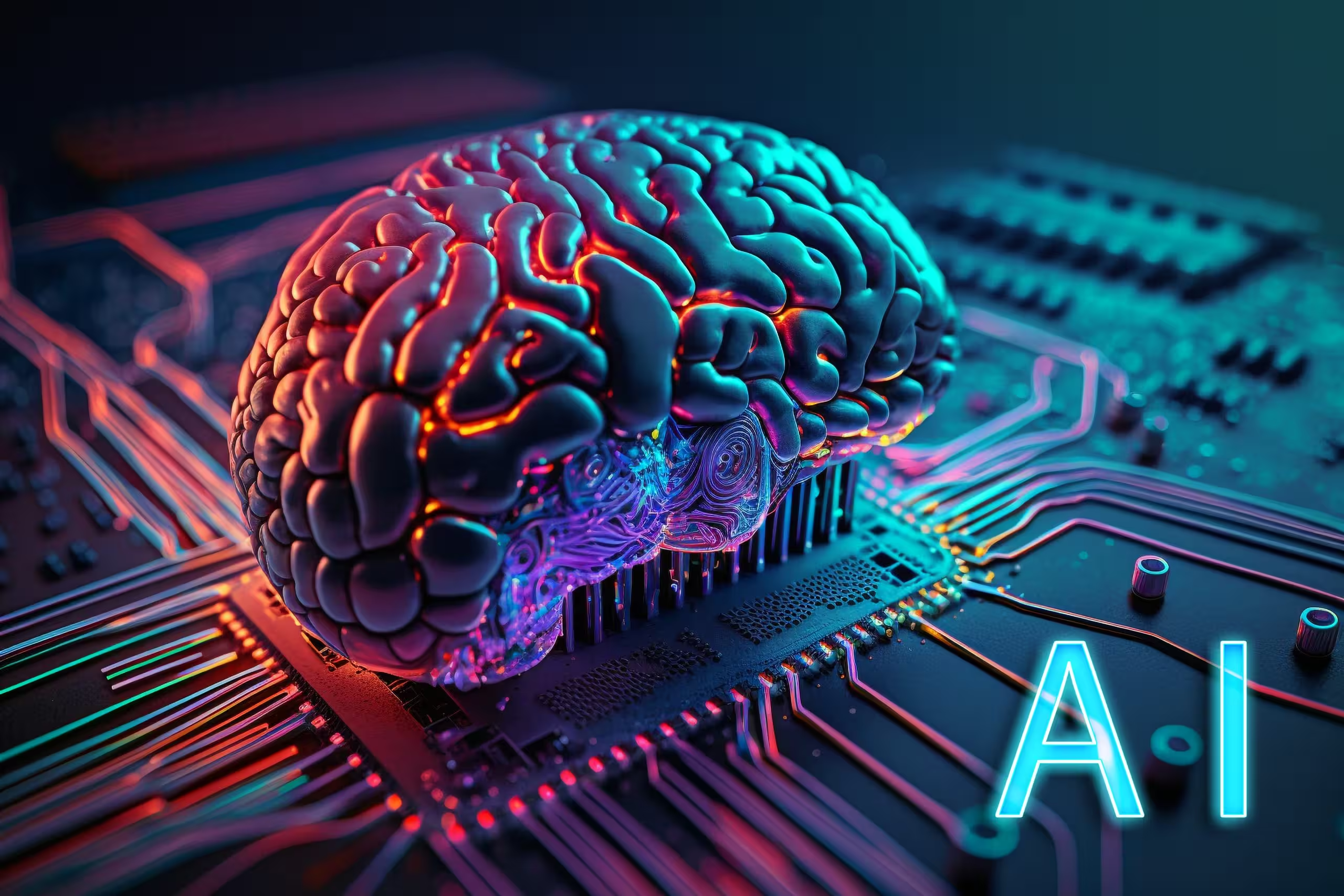
Wie groß könnte KI werden?
Goldman Sachs legt eine mutige Projektion auf den Tisch: Generative KI könnte der US-Wirtschaft bis zu 20 Billionen US-Dollar hinzufügen, wobei ungefähr 8 Billionen US-Dollar als Kapitaleinkommen bei Unternehmen landen könnten. Solche Schätzungen basieren auf Annahmen zu Produktivitätszuwächsen, Skaleneffekten bei Softwareplattformen und der breiten Adoption von KI-gestützten Arbeitsprozessen.
Die Bank schätzt ferner, dass die Arbeitsproduktivität über das nächste Jahrzehnt um etwa 15 % steigen könnte, sofern KI-Tools breit eingesetzt werden. Selbst konservative Szenarien, in denen Routine-Wissensarbeit um 10–20 % effizienter wird, führen durch Kompositionseffekte zu signifikanten Effekten auf Unternehmensgewinne, Arbeitsabläufe und volkswirtschaftliche Kennzahlen.
Sektorspezifische Potenziale
In der Finanzbranche beschleunigt KI die Datenanalyse, das Risikomanagement und die Kundeninteraktion; im Gesundheitswesen unterstützt sie Diagnose, Patienten-Triage und Wirkstoffforschung; in der Fertigung erhöht sie Auslastung, Qualität und Supply-Chain-Resilienz. Generative KI eröffnet zudem neue Produktkategorien – etwa personalisierte Inhalte, automatisierte Codegenerierung und intelligente Assistenzsysteme –, die zusätzliche Nachfrage nach KI-Infrastruktur und -Software erzeugen.
Technische und ökonomische Treiber
Das Potenzial hängt von mehreren technischen und wirtschaftlichen Variablen ab: Verbesserungen in Modellarchitekturen (Effizienz pro Rechenoperation), sinkende Kosten für spezialisierte Hardware (GPUs, TPUs, ASICs), Verfügbarkeit skalierbarer Cloud-Services, sowie regulatorische und ethische Rahmenbedingungen. Wenn Modelle effizienter werden und die Kosten pro Inferenz sinken, erhöht das die Reichweite von KI-Anwendungen in kleineren Unternehmen und latenter Nachfrage.
Nicht alle Investoren werden gewinnen — die Geschichte warnt
Der Bericht blendet Risiken nicht aus. Goldman hebt ein wiederkehrendes Muster aus vergangenen Infrastrukturzyklen hervor: Frühinvestoren tragen oft hohe Aufbaukosten, während spätere Mitbewerber einen Teil der Renditen abschöpfen. Teure, kundenspezifische Systeme können schnell veraltet sein oder durch konsolidierte, standardisierte Angebote ersetzt werden. Bei KI beschleunigt die schnelle technische Entwicklung (schneller steigende Modelle, sinkende Kosten pro Leistung) diese Dynamik zusätzlich.
Das bedeutet: Firmen, die heute massiv in Chips und Server investieren, können dennoch von agileren Wettbewerbern oder Cloud-Anbietern überholt werden, die Infrastruktur standardisieren und als Service anbieten. Kapitalintensive Vorleistungen sind zwar oft notwendig, aber keine Garantie für dauerhafte Marktführerschaft.
Risiken für Frühinvestoren
- Technische Obsoleszenz: Hardware und Modell-Designs veralten schnell.
- Konzentrationsrisiko: Große Cloud-Anbieter können Skalenvorteile nutzen und Margen drücken.
- Fehlallokation: Kapital in proprietäre, schwer portierbare Systeme zu binden erhöht Abschreibungsrisiken.
Strategisch bedeutet das für Unternehmen: Investitionen sollten flexibel, modular und auf Portabilität ausgelegt werden, sodass Workloads zwischen On-Premises und Cloud migrierbar bleiben. Für Investoren heißt es, Chancen entlang der Wertschöpfungskette (Hardware, Software, Services, Plattformen) differenziert zu bewerten.
Ausgaben sollten sich normalisieren, wenn Hardwarekosten fallen
Trotz der Risiken erwartet Goldman, dass das Umfeld für KI-Investitionen günstig bleibt. Die Bank prognostiziert, dass KI-bezogene Ausgaben bis 2025 etwa 300 Milliarden US-Dollar erreichen könnten, da Unternehmen die Adoption erhöhen und Produktivitätsgewinne kumulieren. Diese Zahl umfasst Ausgaben für Chips, Server, Rechenzentren, Cloud-Services und Software-Lizenzen.
Mit fortschreitender Skalierung dürfte die Phase intensiven Infrastrukturaufbaus einer Reifephase weichen, in der fallende Hardwarepreise und standardisierte Angebote zu stabileren Ausgabemustern führen. Sinken die Anschaffungs- und Betriebskosten für GPUs und spezialisierte Beschleuniger, verbessert sich das Verhältnis von Investition zu Nutzen (Return on Investment), was weitere Adoption erleichtert.
Von CAPEX zu OPEX: Verschiebung des Betriebsmodells
Eine wichtige Entwicklung ist die mögliche Verschiebung von CAPEX-lastigen Investitionen hin zu OPEX-orientierten Modellen über Cloud-Provider. Unternehmen, die Rechenkapazitäten als Service beziehen, vermeiden hohe Anfangsinvestitionen und profitieren von Upgrades und Effizienzverbesserungen, während Anbieter von Infrastruktur langfristig von wiederkehrenden Umsätzen profitieren können.
Langfristige Effekte auf Technologiepreise
Die Preisentwicklung für Grafikprozessoren, spezialisierte ASICs und Netzwerk-Infrastruktur wird von Angebot, Nachfrage, Fertigungskapazitäten und geopolitischen Faktoren bestimmt. Parallel dazu treiben Innovationen in Modellkompression, sparsamen Trainingsverfahren und Hardware-naher Optimierung die effektive Leistung pro investiertem Dollar nach oben.
Worauf man als Nächstes achten sollte: Modelle, Chips und Wettbewerb
- Modellentwicklung: Schnellere und effizientere Modelle verändern, wer Wertabschöpfung erzielt – und wie schnell.
- Hardware-Zyklus: Sinkende Preise für GPUs und spezialisierte Beschleuniger verschieben die Wirtschaftlichkeitsgrenzen für Anwender.
- Marktkonsolidierung: Cloud-Anbieter und große Plattformen könnten frühe Investitionen aggregieren, ähnlich früherer Technologiewellen.
Aktuelle Produktveröffentlichungen unterstreichen, wie schnell sich das Umfeld verändert. Google stellte sein Gemini-2.5-Modell mit erweiterten Web-Browsing- und Echtzeit-Interaktionsfähigkeiten vor, was die Integration von generativer KI in interaktive Anwendungen erleichtert. Alibaba kündigte ein massives Modell mit einer Billion Parametern an, das auf Skalierung und Performance zielt und darauf ausgerichtet ist, mit ChatGPT und Google Gemini zu konkurrieren. Diese Entwicklungen zeigen sowohl das Tempo der Innovation als auch den zunehmenden Wettlauf um Rechenleistung und Modellumfang.
Wettbewerbsdynamik und Plattformen
Plattformen, die umfassende Ökosysteme anbieten – von Entwicklungswerkzeugen über Datenverwaltung bis zu Bereitstellungsservices – können Netzwerkeffekte erzeugen, die Markteintrittsbarrieren erhöhen. Gleichzeitig öffnen modulare Open-Source-Modelle und Edge-Computing-Ansätze Nischen für spezialisierte Anbieter, etwa in regulierten Branchen wie Gesundheit oder Finanzen, wo Datenhoheit und Latenz kritische Faktoren sind.
Zu beobachten bleibt, wie sich Geschäftsmodelle weiterentwickeln: Werden Plattformen vorwiegend als Infrastruktur-Anbieter auftreten, oder entstehen hybride Wertschöpfungsmodelle, in denen spezialisierte Softwareanbieter und Systemintegratoren zentrale Rollen spielen?
Was das für Unternehmen und Investoren bedeutet
Für Unternehmen ist die praktische Lehre klar: Investieren Sie dort, wo KI nachweislich Produktivität hebt, und gestalten Sie Projekte modular sowie portabel, um nicht an veraltete Infrastruktur gebunden zu bleiben. Technische Entscheidungen sollten Interoperabilität, Standardisierung und Migrationsfähigkeit zwischen On-Premises-, Hybrid- und Public-Cloud-Umgebungen berücksichtigen.
Für Investoren ist die Botschaft differenziert: KI ist eine mehrjährige Transformation, keine kurzfristige Manie. Das heißt, selektive, langfristig ausgerichtete Positionen in Firmen, die dauerhafte Adoption vorantreiben, sowie in Infrastruktur-Anbieter, die von Skaleneffekten profitieren, erscheinen sinnvoller als breit streuende Wetten ohne Geschäftsmodellverständnis. Diversifikation entlang der Wertschöpfungskette – Hardware, Cloud, Middleware, Endanwender-Software – bleibt eine zentrale Strategie zur Risikosteuerung.
Handlungsempfehlungen für Entscheider
- Priorisieren Sie Use Cases mit klar messbarer Produktivitätssteigerung und positivem ROI.
- Setzen Sie auf modulare Architektur und Containerisierung, um Portabilität zu gewährleisten.
- Evaluieren Sie hybride Betriebsmodelle, um Flexibilität zwischen CAPEX- und OPEX-Lösungen zu bewahren.
- Beachten Sie regulatorische und datenschutzrechtliche Anforderungen bei sensiblen Anwendungen.
Goldmans Fazit lautet: Der KI-Markt erhitzt sich, ist aber noch keine überhitzte Blase. Die eigentliche Entscheidung darüber, wer langfristig profitiert, fällt an drei zentralen Punkten: Wer verwaltet die Infrastruktur-Investitionen strategisch, wer integriert KI erfolgreich in tägliche Arbeitsabläufe, und wie schnell entwickeln sich Hardware- und Modellökonomien weiter. Unternehmen und Investoren, die diese Dynamiken verstehen und sich flexibel aufstellen, haben die besten Chancen, nachhaltig zu profitieren.
Quelle: gizmochina

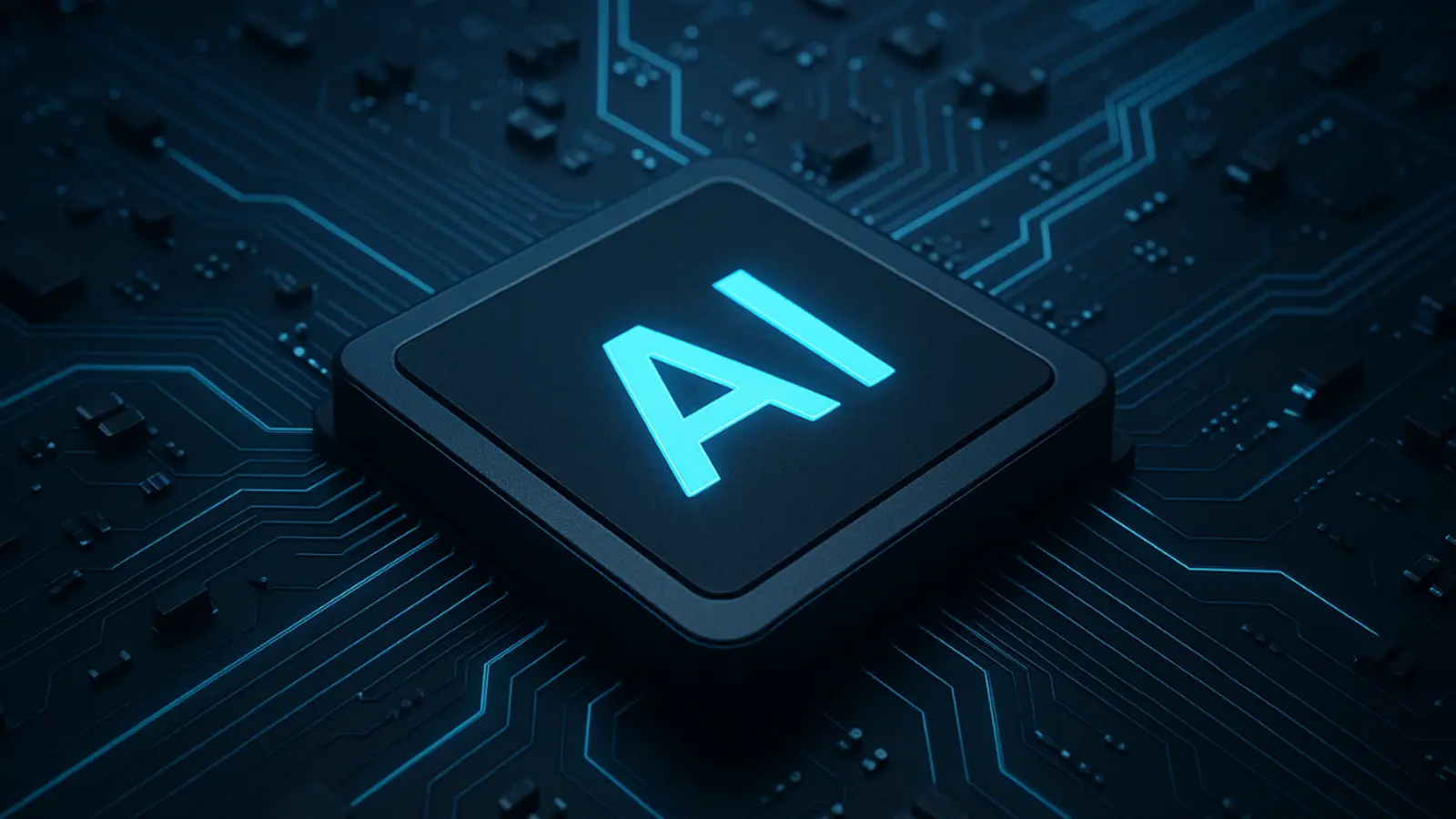
Kommentar hinterlassen