5 Minuten
Eine seltene genetische Besonderheit mit überproportionalen antiviralen Effekten
Eine seltene menschliche Genvariante – ein Mangel an dem interferon‑induzierten Gen 15 (ISG15) – scheint die antiviralen Abwehrmechanismen dauerhaft auf einer niedrigen Alarmstufe zu halten. Das führt zu einer milden, persistierenden Entzündungsreaktion, verschafft Betroffenen jedoch eine breite Resistenz gegenüber vielen alltäglichen Viren. Der Immunologe Dusan Bogunovic von der Columbia University beschrieb dieses ungewöhnliche Erscheinungsbild bereits vor mehr als einem Jahrzehnt. Patienten mit ISG15‑Mangel berichteten, dass sie wiederholt mit Influenza, Masern, Windpocken und Mumps in Kontakt kamen, ohne die typischen Erkrankungen zu entwickeln. Laboranalysen zeigten, dass ihre antiviralen Proteine nie vollständig in den Ruhezustand zurückkehren, sondern ein kontinuierliches, niedriges antivirales Programm aufrechterhalten.
Diese Entdeckung legte eine provokante Idee nahe: Könnte der ISG15‑Defekt kurzfristig und sicher bei anderen Personen nachgeahmt werden, um einen breit wirksamen antiviralen Schutz gegen bekannte und neue Erreger zu bieten? Dieses Konzept wurde jetzt in vorklinischen Studien geprüft, wobei ein Ansatz verwendet wurde, der in der Methodik an mRNA‑Impfstofftechnik erinnert, um das ISG15‑defiziente Immunprofil nur vorübergehend in Labortieren zu simulieren.
Das Experiment: ISG15‑Mangel vorübergehend mittels mRNA‑ähnlicher Methode nachbilden
Die Forschenden lieferten Zielzellen Anweisungen, die die ISG15‑Aktivität reduzierten und gleichzeitig die Expression einer Gruppe von zehn Proteinen erhöhten, die als Hauptvermittler des antiviralen Effekts identifiziert wurden. Diese Proteine greifen an verschiedenen Stellen des viralen Lebenszyklus ein und stören Eintritt, Replikation und Zusammenbau unterschiedlicher Viren. In Zellkulturberichten gibt das Team an, bisher kein Virus gefunden zu haben, das die Abwehrmechanismen überwinden konnte. In Tierversuchen produzierten Mäuse und Hamster, die mit dem transienten ISG15‑unterdrückenden Regime behandelt wurden, höhere Mengen der schützenden Proteine und zeigten nach einer SARS‑CoV‑2‑Herausforderung verringerte Virusreplikation.
Wirkungsweise und Dauer
ISG15 reguliert normalerweise interferongetriebene antivirale Programme. Fehlt es, fällt eine Bremse bei mehreren interferon‑stimulierbaren Genen weg, sodass ein anhaltender, niedrig dosierter antiviraler Zustand entsteht. Die Therapie bewirkt absichtlich einen moderaten Anstieg der zehn Schlüsselproteine für ein begrenztes Zeitfenster – berichteter Schutz hielt bei den behandelten Tieren bis zu vier Tage an – und reduziert damit die Entzündungsbelastung im Vergleich zu lebenslang betroffenen ISG15‑defizienten Patienten, während sie dennoch eine bedeutsame Virusbeschränkung liefert.
Ergebnisse und Wechselwirkungen mit dem Immunsystem
Die behandelten Tiere zeigten eingeschränkte Virusreplikation, ohne dass andere Immunfunktionen offensichtlich breit beeinträchtigt wurden. Bogunovic und seine Kolleginnen und Kollegen betonen, dass der Ansatz lediglich einen kleinen, zeitlich begrenzten Anstieg dieser Proteine hervorruft, der ausreicht, eine Infektion abzuschwächen, aber nicht die chronischen Entzündungsprobleme auslöst, die bei Menschen mit genetischem ISG15‑Mangel beobachtet werden. Das Team schlägt die Technik als potentielles Übergangs‑Instrument vor: kurzzeitiger, unspezifischer antiviraler Schutz für Einsatzkräfte an vorderster Linie oder für Populationen mit akut hohem Risiko in der frühen Phase einer Pandemie, bevor spezifische Impfstoffe verfügbar sind.
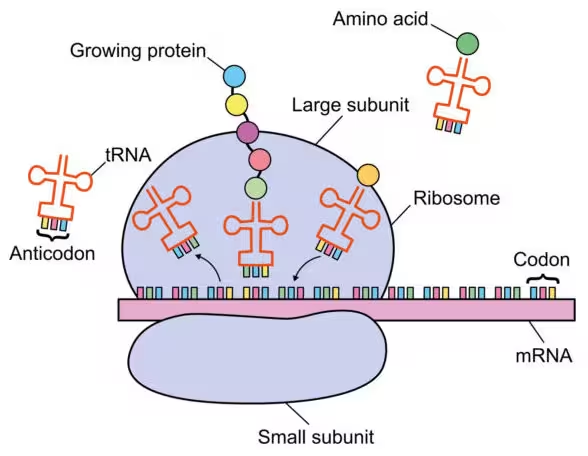
Folgen, Herausforderungen und Ausblick
Sollte sich das Konzept für Menschen validieren und anpassen lassen, könnte vorübergehende ISG15‑Unterdrückung Teil der Pandemie‑Vorsorge werden und breiten Schutz gegen neuartige Atemwegsviren oder andere aufkommende Bedrohungen bieten. Der Ansatz steht im Einklang mit dem wachsenden Interesse an wirtsgerichteten Antivirenmitteln – Strategien, die die Wirtsumgebung für Erreger weniger durchlässig machen, statt jedes Virus direkt anzugreifen.
Dennoch bestehen erhebliche Hürden. Die wichtigste technische Herausforderung ist die zielgerichtete und sichere Abgabe: Nukleinsäuren (mRNA oder ähnliche Konstrukte) in genau die Gewebe oder Zelltypen zu bringen, die Schutz benötigen, ohne Nebenwirkungen an anderen Stellen auszulösen. Wie Bogunovic feststellt: "Sobald die Therapie unsere Zellen erreicht, funktioniert sie, aber die Lieferung jeglicher Nukleinsäure, DNA oder RNA, in den Bereich des Körpers, den man schützen möchte, ist derzeit die größte Herausforderung auf dem Feld." Soziale und politische Vorbehalte gegenüber mRNA‑Technologien in manchen Regionen könnten außerdem Einführung und Einsatz verzögern.
Expertinneneinschätzung: Dr. Priya Sharma, Epidemiologin für Infektionskrankheiten: "Ein vorübergehendes, wirtsgerichtetes Antiviral könnte die Kapazität in Spitzenzeiten und die frühe Ausbruchsreaktion entscheidend verbessern. Die kurze Wirkdauer schränkt eine langfristige Prävention ein, doch zum Schutz von Gesundheitspersonal oder besonders gefährdeten Gruppen während hoher Expositionsphasen könnte es entscheidende Zeit verschaffen, bis spezifische Impfstoffe entwickelt sind. Ob sich das Konzept von vielversprechenden vorklinischen Ergebnissen zu einem praktikablen Instrument entwickelt, hängt wesentlich von Lösung der Liefer‑ und Sicherheitsfragen ab."
Fazit
Die Nachbildung des antiviralen Zustands, wie er bei seltenen ISG15‑defizienten Personen beobachtet wird, mittels vorübergehender, an mRNA erinnernder Technologie brachte in Mäusen und Hamstern kurzzeitigen, breiten antiviralen Schutz. Der Ansatz richtet sich auf wirtsseitige antivirale Proteine statt direkt auf das Virus und könnte als sofortige, unspezifische Abwehr in frühen Pandemiestufen nützlich sein. Vor einem Einsatz beim Menschen müssen allerdings Fragen der Abgabe, Sicherheit und gesellschaftlichen Akzeptanz von Nukleinsäuretherapeutika geklärt werden. Weiterführende Forschung wird zeigen, wie wirksam die Strategie gegen verschiedene Erreger ist und ob sie sich in ein einsatzfähiges Instrument der öffentlichen Gesundheit übersetzen lässt.
Quelle: science

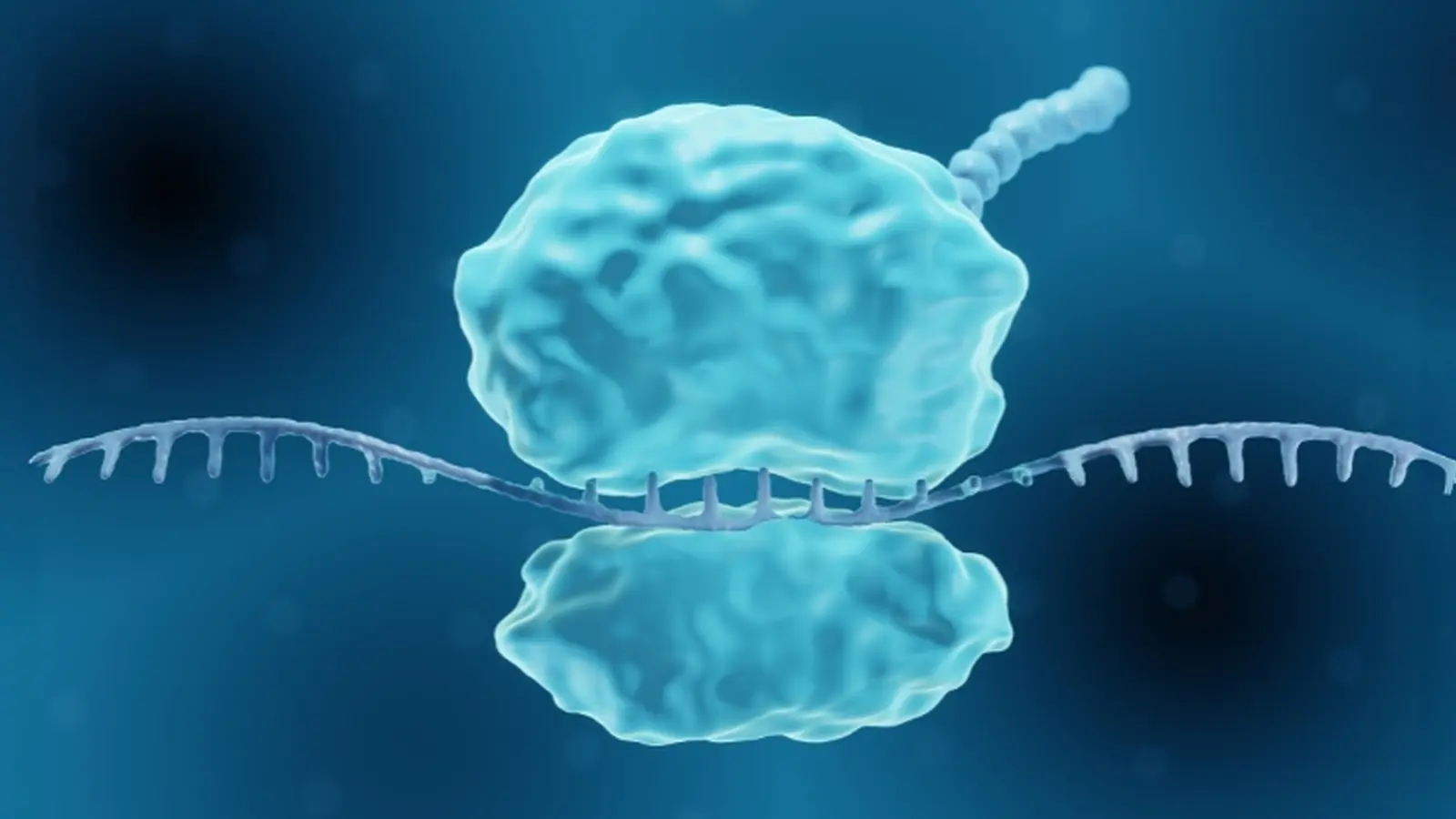
Kommentar hinterlassen