3 Minuten
Die Venus teilt Größe, Masse und grobe Zusammensetzung mit der Erde, doch ihre Umgebung ist radikal anders: eine dichte CO2-Atmosphäre, Oberflächentemperaturen heiß genug, um Blei zu schmelzen, Schwefelsäurewolken, eine langsame retrograde Rotation und keine natürlichen Satelliten. Eine neue Simulationsstudie unter der Leitung von Mirco Bussmann an der Universität Zürich prüft, ob eine einzelne, große Kollision mit einem marsgroßen Körper in der frühen Geschichte der Venus sowohl ihren ungewöhnlichen Drehzustand als auch das Fehlen eines Mondes erklären kann.
Simulationsmethoden und Aufbau
Massiver Asteroid prallt auf einen Planeten - hideto999/Shutterstock
Das Forscherteam verwendete Smooth Particle Hydrodynamics (SPH), eine numerische Methode, die Planeten als Ansammlungen von Partikeln modelliert, denen physikalische Eigenschaften zugewiesen sind. Ihr Venus-Analog bestand aus einem Eisenkern (etwa 30% der Masse) und einem silikatischen Mantel (etwa 70%). Die Impaktoren reichten von 0,01 bis 0,1 Erdmassen (bis etwa Marsgröße) und näherten sich mit 10–15 km/s. Die Simulationen untersuchten eine Matrix aus Einschlagwinkeln, Geschwindigkeiten sowie unterschiedlichen Anfangsrotationen und thermischen Zuständen der Venus, um zwei Ergebnisse zu messen: Änderungen der Rotationsperiode und die Menge an Trümmern, die in eine Umlaufbahn gelangten (eine zirkumplanetare Scheibe, aus der sich ein Mond bilden könnte).
Wichtige Simulationsparameter
- Innenstruktur: Eisenkern ~30% / silikatischer Mantel ~70%
- Impaktor-Massen: 0,01–0,1 Erdmassen
- Einschlaggeschwindigkeiten: 10–15 km/s
- Variierte Einschlagwinkel sowie anfängliche Rotation/thermisches Profil des Planeten

Wesentliche Ergebnisse und Implikationen
In einem breiten Spektrum an Szenarien können einzelne große Einschläge (a) die Rotation der Venus umkehren oder erheblich verlangsamen und so den heutigen retrograden, sehr langen Tag erzeugen, und (b) in der Regel keine bedeutende zirkumplanetare Trümmerscheibe hinterlassen. Die meisten Kollisionsreste fallen entweder in die Atmosphäre zurück oder re-akkretierten auf den Planeten, wodurch die stabile Satellitenbildung, die den Mond der Erde entstehen ließ, verhindert wird. Die Studie zeigt außerdem, dass ein solcher Einschlag enorme Wärmemengen in Venuss Mantel eintragen würde, die Mantelkonvektion stören und wahrscheinlich die Plattentektonik über lange Zeitenräume unterdrücken könnten. Dieser thermische Reset bietet einen plausiblen Mechanismus für die planetenweite vulkanische Neubesiedelung, die die relativ junge Oberfläche der Venus und die geringe Kraterzahl erklärt.
Hauptautor Mirco Bussmann und seine Kollegen betonen, dass ein einzelner marsgroßer Einschlag nicht die einzige mögliche Erklärung ist, doch ihre Modelle zeigen, dass es ein robustes, in sich stimmiges Szenario ist, das die Rotation der Venus, das Fehlen eines Satelliten und die geologische Entwicklung verknüpft.
Schlussfolgerung
SPH-Simulationen der Universität Zürich zeigen, dass ein marsgroßer Einschlag in der frühen Geschichte der Venus gleichzeitig die langsame retrograde Rotation des Planeten, das Fehlen eines Mondes und die globale vulkanische Neubesiedelung erklären kann. Die Ergebnisse stärken die Annahme, dass Riesen-Kollisionen die auseinandergehenden Entwicklungspfade von Erde und Venus geprägt haben, und heben hervor, wie Einschlagsdynamik, Reaktion des planetaren Inneren und Produktion von Umlaufbahntrümmern zusammenspielen, um die langfristige Geologie und das Satellitensystem eines Planeten zu bestimmen.
Quelle: yahoo

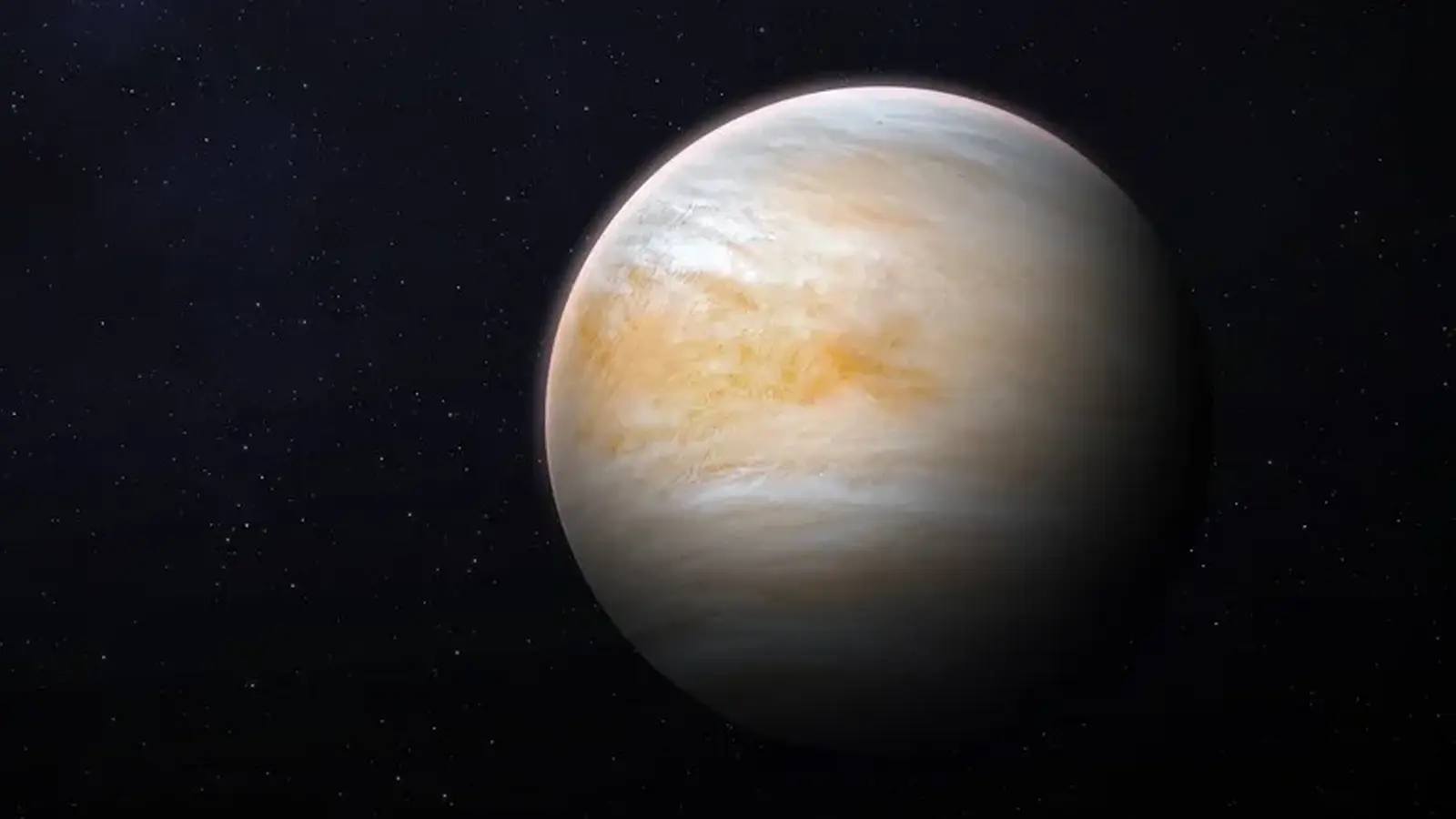
Kommentar hinterlassen