6 Minuten
Semaglutid und andere Glucagon-like Peptid‑1 (GLP‑1) Rezeptoragonisten haben die klinischen Erwartungen an die Adipositasbehandlung verändert, indem sie bei vielen Patientinnen und Patienten einen erheblichen und anhaltenden Gewichtsverlust bewirken. Eine große bevölkerungsweite Studie aus Dänemark, vorgestellt beim European Association for the Study of Diabetes (EASD), zeigt jedoch eine deutliche Lücke zwischen dem klinischen Potenzial und der realen Anwendung: Mehr als 50% der Erwachsenen ohne Diabetes, die Semaglutid begonnen haben, setzten das Präparat innerhalb eines Jahres ab.
Studienaufbau und Datenquellen
Die Forschenden nutzten nationale Gesundheitsregister, um alle Erwachsenen (ab 18 Jahren) in Dänemark zu identifizieren, die Semaglutid zur Gewichtsreduktion zwischen dem nationalen Markteintritt am 1. Dezember 2022 und dem 1. Oktober 2023 begonnen hatten. Die Analyse erfasste Abholmuster von Verschreibungen für 77.310 erstmalige Semaglutid‑Anwender ohne Diabetes und ermöglichte bevölkerungsbezogene Schätzungen der Therapieabbrüche nach 3, 6, 9 und 12 Monaten nach Beginn.
Nach einem Jahr nahmen 40.262 Personen (Medianalter 50 Jahre; 72% Frauen) Semaglutid nicht mehr ein. Die Abbruchraten lagen bei 18% nach 3 Monaten, 31% nach 6 Monaten und 42% nach 9 Monaten und führten zu einem >50%igen Abbruch bis zum 12. Monat.
Wesentliche Ergebnisse: Wer bricht ab und warum
Die Forschenden identifizierten mehrere Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhten, Semaglutid im ersten Jahr abzusetzen:
- Jüngeres Alter: Erwachsene im Alter von 18–29 Jahren hatten eine um 48% höhere Wahrscheinlichkeit, abzubrechen, als Personen im Alter von 45–59 Jahren (nach Alters‑ und Geschlechtsanpassung).
- Geringe Einkommen: Menschen in einkommensschwächeren Wohnvierteln setzten die Therapie mit einer um 14% höheren Wahrscheinlichkeit ab als Personen in wohlhabenderen Gegenden.
- Vorherige Einnahme von Magen‑Darm‑Medikamenten: Ein Indikator für eine Anfälligkeit gegenüber gastrointestinalen Nebenwirkungen (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) sagte eine um 9% höhere Abbruchrate voraus.
- Psychische und chronische Erkrankungen: Personen mit vorheriger psychiatrischer Medikation brachen zu 12% häufiger ab; diejenigen mit Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen oder anderen chronischen Krankheiten hatten etwa ein 10% höheres Abbruchsrisiko.
- Geschlechtsunterschiede: Männer setzten die Behandlung innerhalb eines Jahres mit einer um 12% höheren Wahrscheinlichkeit ab als Frauen.
Die Kosten stellten eine wichtige praktische Barriere dar: Stand Juni 2025 kostete die niedrigste Semaglutid‑Dosis in Dänemark ungefähr €2.000 pro Jahr, ein Preis, der vermutlich zu höheren Abbruchraten bei Jüngeren und Menschen in einkommensschwächeren Regionen beiträgt.

Wissenschaftlicher Hintergrund und klinischer Kontext
GLP‑1‑Rezeptoragonisten wie Semaglutid wirken an Rezeptoren im Darm und Gehirn, um das Hungergefühl zu reduzieren und das Sättigungsgefühl zu verstärken. Ursprünglich zur Behandlung von Typ‑2‑Diabetes entwickelt, zeigten diese Medikamente positive Nebeneffekte auf das Körpergewicht, was zu Zulassungen für Adipositasindikation führte. Der Mechanismus, der Appetit während der Therapie kontrolliert, programmiert jedoch nicht zwangsläufig das langfristige Energiegleichgewicht um. Es gibt Hinweise, dass das Gewicht nach Absetzen der Medikation häufig wieder ansteigt, sodass ein anhaltender Nutzen normalerweise eine kontinuierliche Einnahme erfordert.
Professor Reimar W. Thomsen, Erstautor und Epidemiologe an der Universität Aarhus, betonte die klinische Bedeutung: "Dieses Ausmaß an Abbrüchen ist besorgniserregend, weil diese Medikamente nicht als vorübergehender Schnellfix gedacht sind. Damit sie effektiv wirken, müssen sie langfristig eingenommen werden. Alle vorteilhaften Effekte auf die Appetitkontrolle gehen verloren, wenn das Medikament abgesetzt wird."
Nebenwirkungen und Gerechtigkeitsbedenken
Magen‑Darm‑Nebenwirkungen — Übelkeit, Erbrechen und Durchfall — werden häufig früh in der Therapie berichtet und scheinen zum Absetzen beizutragen, wie die Assoziation mit vorheriger GI‑Medikationsnutzung nahelegt. Die Studie unterstreicht zudem Risiken für die Versorgungs‑Gerechtigkeit: Hohe Zuzahlungen können gesundheitliche Ungleichheiten vergrößern, da die Prävalenz von Adipositas in marginalisierten, ethnischen und sozioökonomisch benachteiligten Gruppen höher ist und diese oft weniger Zugang zu langfristiger Pharmakotherapie haben.
Beschränkungen der Analyse
Die Autorinnen und Autoren verweisen auf die Grenzen registerbasierter Studien: Individuelle BMI‑Werte und genaue Gewichtsverlustdaten waren nicht verfügbar, ebenso wenig Details zur privaten Krankenversicherungsdeckung oder zu direkten Patientenzuzahlungen. Leichtere Nebenwirkungen oder subjektive Absetzgründe (z. B. empfundener unzureichender Gewichtsverlust, Familienplanung, persönliche Präferenzen) werden in Verschreibungsregistern unzureichend erfasst. Diese Lücken bedeuten, dass die tatsächliche Mischung aus klinischen, sozialen und finanziellen Treibern des Absetzens breiter sein kann, als die Registerdaten zeigen.
Folgen und zukünftige Richtungen
Hohe frühe Abbruchraten haben vielfältige Folgen. Klinisch führt das Absetzen von Semaglutid häufig zu einer Gewichtszunahme und negiert frühere Erfolge. Aus gesundheitspolitischer Sicht verursachen verschwendete Behandlungszyklen zusätzliche Kosten, ohne anhaltenden Nutzen zu liefern. Politische Antworten könnten verhandelte Preise, Erstattungsstrategien zur Reduktion der Zuzahlungen und integrierte Versorgungsmodelle umfassen, die Pharmakotherapie mit verhaltensmedizinischer, ernährungsbezogener und psychischer Unterstützung kombinieren, um die Adhärenz zu verbessern.
Expertinneneinschätzung
"Anhaltende Erfolge mit GLP‑1‑Therapien hängen von mehr ab als vom Medikament selbst", sagt Dr. Elena Martín, Fachärztin für Adipositasbehandlung, die nicht an der Studie beteiligt war. "Wir brauchen Adhärenz‑Strategien, die Nebenwirkungen adressieren, realistische Erwartungen an Gewichtsverläufe schaffen und die finanziellen Barrieren vieler Patientinnen und Patienten berücksichtigen. Die Kombination von Pharmakotherapie mit strukturiertem Follow‑up — einschließlich Dosisanpassung, Symptommanagement und psychosozialer Unterstützung — kann frühe Abbrüche reduzieren und langfristige Ergebnisse verbessern."
Fazit
Die dänische Registerstudie liefert robuste, bevölkerungsbezogene Evidenz dafür, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen ohne Diabetes innerhalb eines Jahres Semaglutid absetzt. Kosten, gastrointestinale Nebenwirkungen, psychiatrische und chronische Komorbiditäten sowie demografische Faktoren wie jüngeres Alter und männliches Geschlecht tragen alle zu frühen Therapieabbrüchen bei. Da ein Gewichtsanstieg häufig dem Behandlungsabbruch folgt, wird es entscheidend sein, die Langzeitadhärenz durch gesundheitspolitische Maßnahmen, klinische Unterstützung und besseren Zugang zu verbessern, um das volle öffentlich‑gesundheitliche Potenzial von GLP‑1‑Rezeptoragonisten in der Adipositasversorgung auszuschöpfen.
Quelle: sciencedaily

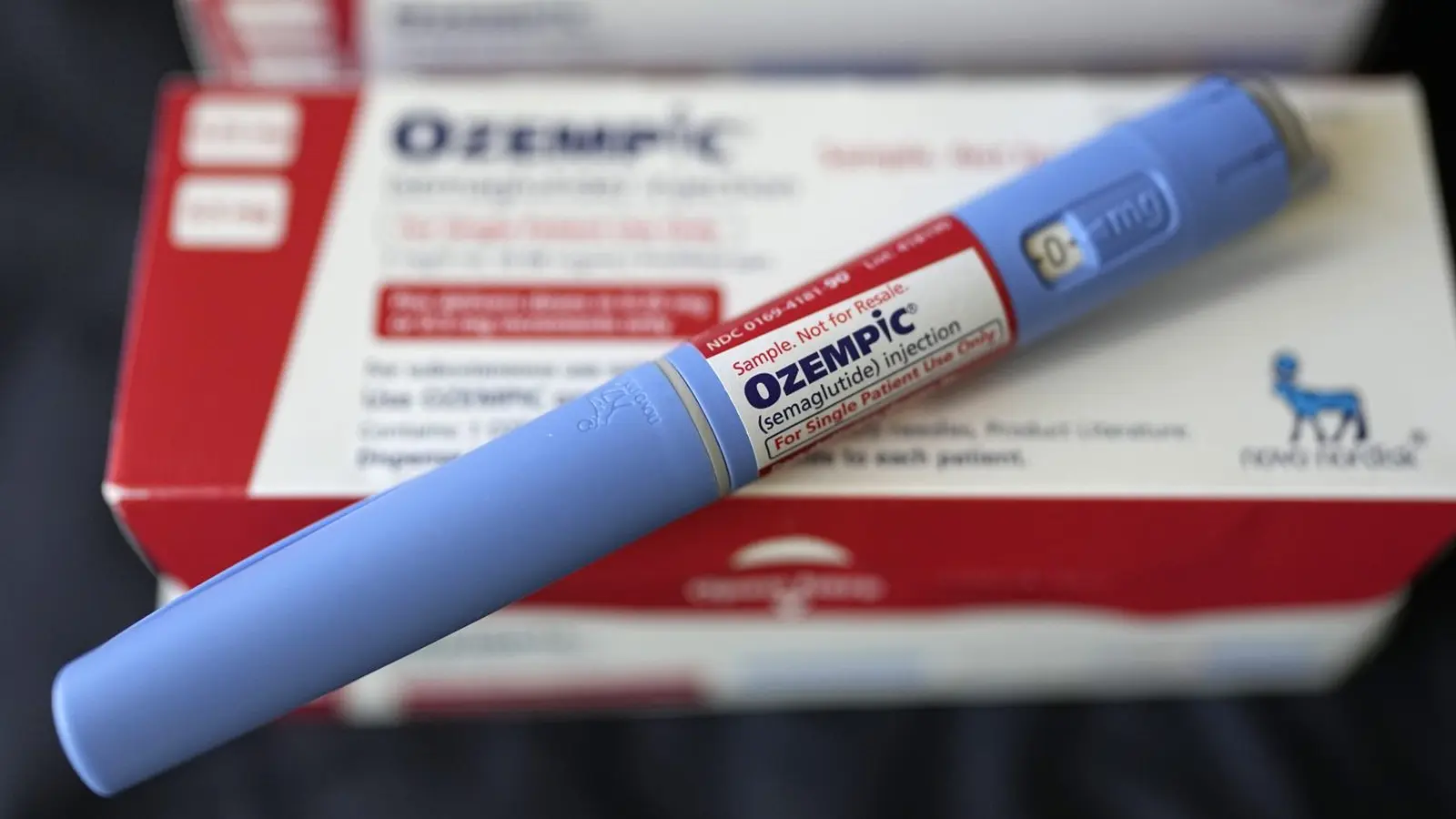
Kommentar hinterlassen