6 Minuten
Künstliche Intelligenz (KI) kann inzwischen erkennen, welche Patienten mit Keratokonus voraussichtlich eine schädliche Krankheitsprogression erfahren, Jahre bevor konventionelle klinische Kontrollen Veränderungen zeigen. Auf dem 43. Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) wurde eine neue Studie des Moorfields Eye Hospital und des University College London vorgestellt, die zeigt, dass maschinelles Lernen, angewandt auf Hornhautscans und klinische Daten, Patienten zuverlässig für eine frühzeitige Behandlung oder eine sichere Überwachung einstufen kann. Der Ansatz verspricht, irreversiblen Sehverlust zu verhindern, Hornhauttransplantationen zu verringern und die Ressourcenzuteilung in der Augenheilkunde zu verbessern.
Wissenschaftlicher Hintergrund: Was ist Keratokonus und warum das Timing wichtig ist
Keratokonus ist eine degenerative Erkrankung der Hornhaut, die typischerweise in der Adoleszenz beginnt und bis ins Erwachsenenalter fortschreitet. Dabei dünnt die normalerweise kuppelförmige Hornhaut aus und wölbt sich nach außen. Die verzerrte Hornhaut führt zu unscharfem oder verzerrtem Sehen und kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Schätzungen gehen davon aus, dass Keratokonus in manchen Populationen bis zu 1 von 350 Menschen betrifft. Die Behandlung reicht von speziellen Kontaktlinsen bis zu einem minimalinvasiven Verfahren namens Hornhaut-Crosslinking (CXL), bei dem Riboflavin (Vitamin B2) und ultraviolettes Licht verwendet werden, um die Hornhaut zu versteifen und zu stabilisieren.
Ein frühzeitiges CXL — durchgeführt, bevor es zu bleibenden Narben oder starker Ausdünnung kommt — kann das Fortschreiten stoppen und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Notwendigkeit einer Hornhauttransplantation verhindern. Die klinische Herausforderung besteht darin, vorherzusagen, wer fortschreiten wird. Heute benötigen die meisten Patienten jahrelange regelmäßige Kontrollen mit optischer Kohärenztomographie (OCT) und biomechanischen Untersuchungen, um eine Progression zu erkennen; bis die Verschlechterung bestätigt ist, sind manche Schäden bereits irreversibel.
Studiendesign und KI-Leistung
Forscher unter Leitung von Dr. Shafi Balal analysierten eine große retrospektive Kohorte von Patienten, die zur Beurteilung und Überwachung von Keratokonus an das Moorfields Eye Hospital überwiesen wurden. Das Team kombinierte 36.673 OCT-Bilder von 6.684 einzelnen Patienten mit routinemäßigen klinischen Daten und trainierte einen KI-Algorithmus, um den Krankheitsverlauf bereits beim ersten klinischen Besuch vorherzusagen.

Wesentliche Ergebnisse
Das Modell teilte Patienten in klinisch nützliche Risikogruppen ein: etwa zwei Drittel wurden als geringes Risiko klassifiziert (geeignet für fortgesetzte Überwachung), und etwa ein Drittel wurde als hohes Risiko identifiziert und für eine zeitnahe Crosslinking-Behandlung empfohlen. Wenn der Algorithmus Bilddaten und Informationen vom zweiten Besuch erhielt, stieg die Genauigkeit weiter — er klassifizierte dann bis zu 90 % der Patienten korrekt. In der Literatur liegen die Erfolgsraten von Crosslinking bei über 95 %, wenn es vor strukturellen Narben durchgeführt wird, was das Potenzial einer frühzeitigen, KI-gestützten Intervention unterstreicht.
Dr. Balal fasste die Ergebnisse zusammen: „Unsere Forschung zeigt, dass wir KI einsetzen können, um vorherzusagen, welche Patienten eine Behandlung benötigen und welche weiter überwacht werden können. Dies ist die erste Studie dieser Art, die dieses Genauigkeitsniveau bei der Vorhersage des Progressionsrisikos von Keratokonus aus einer Kombination von Scans und Patientendaten erreicht.“ Er wies darauf hin, dass in der aktuellen Arbeit ein OCT-Gerät verwendet wurde, die Methoden und der Algorithmus jedoch an andere Bildgebungssysteme angepasst werden können und vor der klinischen Einführung weitere Sicherheitstests durchlaufen werden.
Klinische Implikationen und Vorteile für das Gesundheitssystem
Wird die Methode in prospektiven multizentrischen Studien validiert, könnte die algorithmische Triage die Keratokonus-Versorgung von reaktiv zu proaktiv verlagern. Erwartete Vorteile sind:
- Vermeidung vermeidbaren Sehverlusts durch rechtzeitiges Crosslinking bevor irreversible Narben entstehen.
- Reduktion der Anzahl von Hornhauttransplantationen sowie der damit verbundenen Komplikationen und Rehabilitationsbelastung.
- Verringerung der Häufigkeit unnötiger Klinikbesuche für Niedrigrisiko-Patienten und damit Freisetzung von Kapazitäten für komplexere Fälle.
- Ermöglichung, dass Spezialisten Patienten mit dem größten Bedarf priorisieren können, wodurch die gesamten Versorgungspfade verbessert werden.
Dr. José Luis Güell, ESCRS-Trustee und Leiter der Abteilung für Hornhaut-, Katarakt- und refraktive Chirurgie am Instituto de Microcirugía Ocular (nicht an der Studie beteiligt), kommentierte: „Keratokonus ist eine behandelbare Erkrankung, aber zu wissen, wen man behandeln sollte, wann und wie, ist eine Herausforderung. Leider kann dieses Problem zu Verzögerungen führen, sodass viele Patienten Sehverlust erleiden und invasive Implantat- oder Transplantationsoperationen benötigen.“ Seine Bemerkungen unterstreichen die klinische Dringlichkeit einer besseren Risikostratifizierung.
Einschränkungen, Validierung und nächste Schritte
Zu den Einschränkungen der Studie gehört die Abhängigkeit von Daten eines einzelnen OCT-Geräts und das retrospektive Studiendesign. Die Autoren räumen ein, dass prospektive Validierungen mit verschiedenen Geräten, Patientengruppen und Gesundheitssystemen erforderlich sind, um die Generalisierbarkeit zu bestätigen. Der Algorithmus wird vor einer klinischen Einführung Sicherheitsprüfungen und behördliche Bewertungen durchlaufen.
Die Forscher planen bereits eine nächste Generation von KI, die an Millionen von Augen-Scans trainiert werden soll, um die Fähigkeiten über die Keratokonus-Vorhersage hinaus zu erweitern. Mögliche Erweiterungen umfassen die automatisierte Erkennung von Hornhautinfektionen, die frühe Identifikation angeborener Netzhaut- oder Hornhauterkrankungen und die Integration in elektronische Gesundheitsakten für longitudinale Risikomodelle.
Experteneinschätzung
Dr. Maya Thompson, beratende Augenärztin und Forscherin im Bereich KI im Gesundheitswesen, gibt eine praxisnahe Einschätzung: „Machine-Learning-Modelle sind nur so nützlich wie ihre Integration in den klinischen Workflow. Für Keratokonus wäre ein validiertes Triage-Tool transformativ — es würde Kliniker befähigen, das Crosslinking frühzeitig den richtigen Patienten anzubieten und gleichzeitig die Nachsorge für andere sicher zu reduzieren. Kritische nächste Schritte sind multizentrische Studien, transparente Leistungsberichte nach Gerätetyp und klare Wege für Patientenaufklärung und Datenverwaltung. Richtig eingesetzt kann KI sowohl das Sehvermögen schützen als auch die Belastung der Augenheilversorgung verringern.“
Verwandte Technologien und Zukunftsaussichten
Die Arbeit steht an der Schnittstelle von ophthalmischer Bildgebung, computergestützter Diagnostik und translationeller KI. Wichtige Ermöglichungstechnologien sind hochauflösende OCT, skalierbares cloudbasiertes Modelltraining und interoperable elektronische Gesundheitsakten. Regulatorische Rahmenbedingungen für medizinische KI, angewandte klinische Studien und die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten werden bestimmen, wie schnell diagnostische Algorithmen von der Forschung in die Routineversorgung gelangen.
Fazit
Die Studie zeigt, dass KI, angewandt auf Zehntausende von OCT-Scans und klinischen Datensätzen, den Verlauf von Keratokonus frühzeitig vorhersagen kann, sodass Behandlungsentscheidungen beeinflusst werden können. Durch gezieltes, rechtzeitiges Hornhaut-Crosslinking könnte die Technologie Sehverlust verhindern, Transplantationsraten senken und Ressourcen in der Augenheilkunde optimieren. Vor weiteren Validierungen und geräteunabhängigen Tests stellt die algorithmische Risikostratifizierung einen vielversprechenden Schritt in Richtung personalisierter, präventiver Augenversorgung dar.
Quelle: sciencedaily

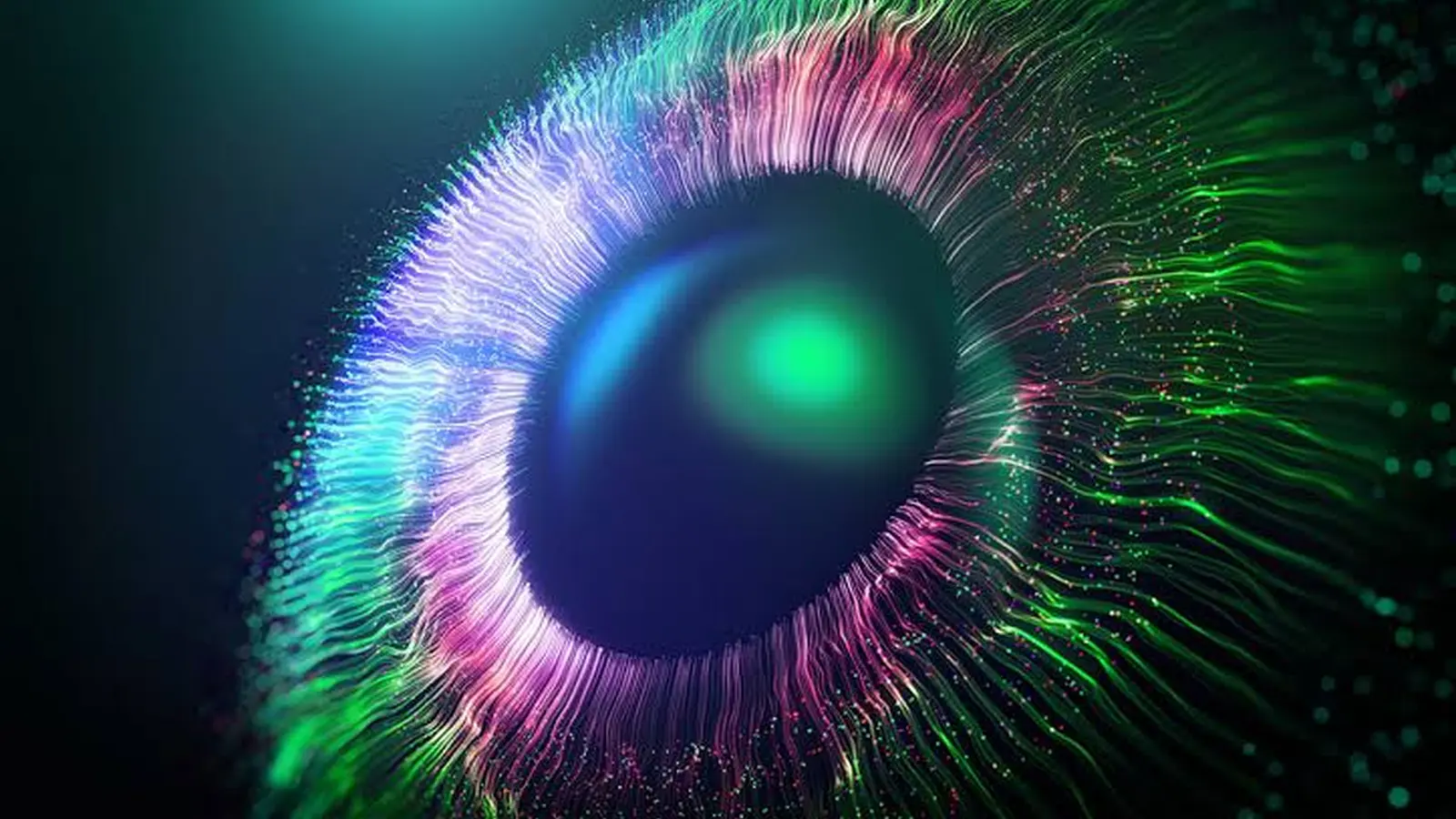
Kommentar hinterlassen