6 Minuten
Prochlorococcus: eine Meeresmikrobe mit globaler Reichweite
Prochlorococcus ist ein winziges, marines Cyanobakterium, das eine überproportionale Rolle in der Biosphäre der Erde spielt. Obwohl mikroskopisch klein, wird geschätzt, dass es mehr als 75% der sonnenbeschienenen Oberflächengewässer des Planeten bewohnt und durch Photosynthese ungefähr ein Drittel der globalen ozeanischen Sauerstoffproduktion beiträgt. Seine Häufigkeit in tropischen und subtropischen offenen Ozeanen hilft, Nahrungsnetze und den Kohlenstoffkreislauf in nährstoffarmen Oberflächengewässern zu stützen.
Eine neue mehrjährige Analyse unter Leitung des Ozeanografen François Ribalet an der University of Washington deutet darauf hin, dass steigende Meerestemperaturen das Wachstum und die Produktivität von Prochlorococcus in bislang unterschätztem Ausmaß reduzieren könnten. Die Studie kombinierte umfangreiche Messungen an Bord von Forschungsschiffen mit statistischen Wachstumsmodellen, um zu beurteilen, wie wilde Populationen dieses Schlüssel-Mikroben in situ auf Temperatur reagieren.
Feldmethoden und Datensatz: direkte Messung wilder Mikroben
Um über laborbasierte Schätzungen hinauszugehen, entnahmen die Forschenden Proben von Prochlorococcus in seiner natürlichen Umgebung. Über 13 Jahre und 90 Forschungsexpeditionen stießen sie auf und analysierten rund 800 Milliarden zellgroße Partikel im Größenbereich von Prochlorococcus. Messungen erfolgten mit einem an Bord eingesetzten Durchflusszytometer, das Ribalet mitentwickelt hatte, um winzige Phytoplanktonzellen wie Prochlorococcus mittels laserbasierter optischer Detektion zu erfassen und zu messen. Das Instrument erlaubte eine wenig invasive Quantifizierung der Zellzahlen und von Indikatoren für Zellteilung über weite Breitengrade hinweg.
Anhand dieser in situ-Beobachtungen wendete das Team etablierte statistische Modelle an, um Wachstumsraten bei verschiedenen Wassertemperaturen und Regionen zu schätzen. Die Ergebnisse zeigten deutliche latitudinale Muster der Zellteilung, die enger mit der Meeressurface-Temperatur als mit Lichtverfügbarkeit oder Nährstoffkonzentrationen korrelierten.
Wesentliche Ergebnisse: ein schmaleres Temperaturfenster als erwartet
Die Studie ergab, dass Prochlorococcus am besten in einem mäßig warmen Bereich zwischen etwa 19 und 28 °C (66–82 °F) gedeiht. Entgegen früherer Annahmen, wonach diese hitzeangepasste Gattung bei weiterer Erwärmung profitieren würde, beobachteten die Forschenden einen steilen Rückgang der Zellteilung bei Temperaturen oberhalb von etwa 30 °C. Bei diesen höheren Temperaturen sanken die Teilungsraten auf etwa ein Drittel der Werte am unteren Ende des tolerierten Bereichs.
„Ihre Ausbrenntemperatur liegt viel niedriger, als wir dachten“, sagte Ribalet und fasste damit eine unerwartete Empfindlichkeit in den heißesten tropischen Gewässern zusammen. Klimamodellprojektionen deuten darauf hin, dass viele tropische und subtropische Oberflächengewässer unter verbreiteten Erwärmungsszenarien noch in diesem Jahrhundert die optimale obere Grenze von Prochlorococcus überschreiten könnten.
Ökologische und biogeochemische Implikationen
Da Prochlorococcus so häufig vorkommt und maßgeblich zur primären Produktion beiträgt, würde ein Rückgang seiner Produktivität die Menge an Kohlenstoff und organischem Material verringern, die für höhere trophische Ebenen verfügbar ist. Die Autorinnen und Autoren schätzen, dass die tropische Produktivität von Prochlorococcus bis zum Ende des Jahrhunderts unter einem moderaten Erwärmungsszenario um etwa 17% sinken könnte und unter einem starken Erwärmungspfad um bis zu 51%. Global wurden Produktivitätsrückgänge von rund 10% (moderat) bis 37% (stark) projiziert.
Ein Schrumpfen der Produktivität ist zudem mit einer latitudinalen Umverteilung verbunden: Es wird erwartet, dass sich das Verbreitungsgebiet von Prochlorococcus polwärts verschiebt und in höhere Breiten ausdehnt, während die Häufigkeit in äquatorialen Regionen abnimmt.
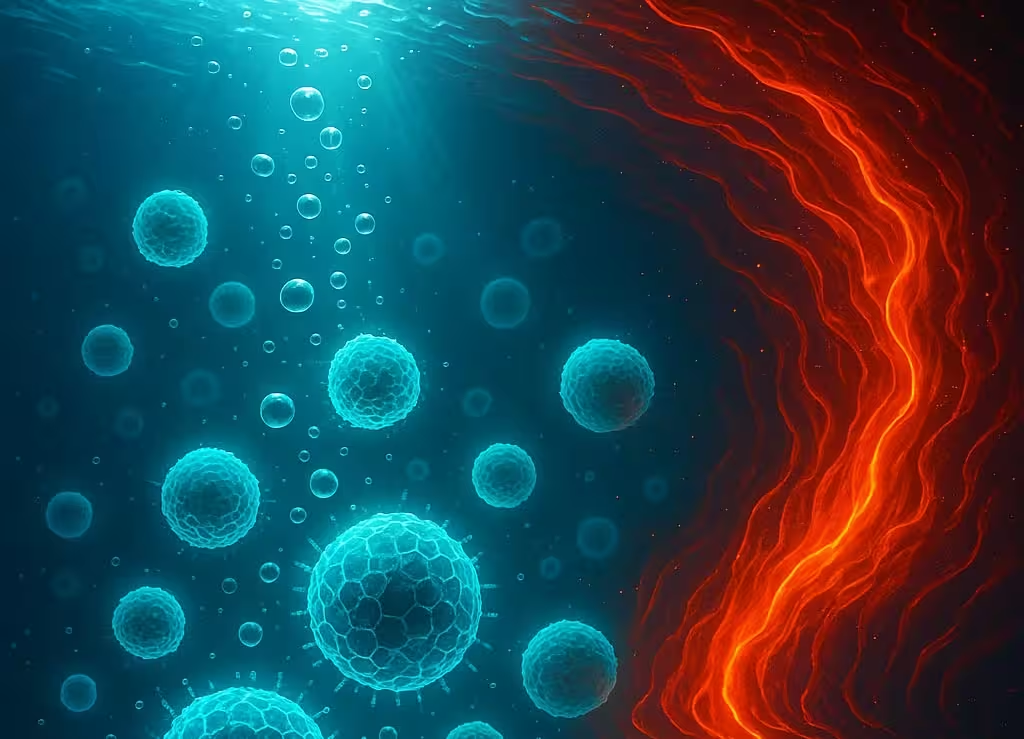
Konkurrenten und genomische Beschränkungen
Prochlorococcus hat sich an warme, nährstoffarme Oberflächengewässer angepasst, unter anderem durch sehr kleine Zellgrößen und ein stark reduziertes Genom, das wesentliche Funktionen beibehält und nicht notwendige Gene abgebaut hat. Während diese Genomreduktion in nährstoffarmen Umgebungen Effizienz bringt, könnte sie auch bestimmte alte Stressantwortgene eliminiert haben. Diese genomische Minimalisierung könnte die Widerstandsfähigkeit des Mikroben gegenüber schnellen Temperaturanstiegen verringern.
Diese Verwundbarkeit könnte Raum für andere Cyanobakterien schaffen, etwa Synechococcus, die höhere Temperaturen besser tolerieren, aber im Allgemeinen mehr Nährstoffe benötigen. Sollte Synechococcus Nischen besetzen, die von Prochlorococcus aufgegeben werden, könnte sich die Struktur mikrobieller Nahrungsnetze sowie das Zusammenspiel mit Weidetieren und Viren auf unvorhersehbare Weise ändern. „Wenn Synechococcus übernimmt, ist nicht gewährleistet, dass andere Organismen in gleicher Weise mit ihm interagieren können, wie sie es über Millionen von Jahren mit Prochlorococcus getan haben“, bemerkte Ribalet.
Einschränkungen und Unsicherheiten
Die Autorinnen und Autoren betonen die Grenzen ihres Ansatzes. Die an Bord eingesetzte Zytometrie und die statistischen Modelle könnten seltene, hitzetolerante Prochlorococcus-Stämme untererfassen. Obwohl der Datensatz viele Ozeanregionen abdeckt, wurden mehrere wichtige tropische Gebiete nicht beprobt. Die Forschenden präsentieren ihre Schlussfolgerungen als die einfachste Erklärung, die mit den aktuellen Daten konsistent ist, und räumen ein, dass die Entdeckung hitzetoleranter Genotypen die Projektionen verändern und mögliche Resilienz bieten würde.
Experteneinschätzung
Dr. Aisha Khan, eine fiktive Meeresmikrobielle Ökologin am Scripps Institution of Oceanography, kommentiert: „Diese Studie liefert wichtige in situ‑Belege, die unser Verständnis mikrobieller thermischer Nischen verfeinern. Laborexperimente sind notwendig, aber Feldmessungen erfassen Gemeinschaftsantworten im realen Variabilitätskontext. Wenn die Produktivität von Prochlorococcus wie prognostiziert zurückgeht, sollten wir kaskadierende Effekte auf ozeanische Kohlenstoffpfade und die Nahrungsnetze erwarten, die von mikrobiellem Primärproduzenten abhängen.“
Breiterer Kontext und Aussichten
Die Ergebnisse unterstreichen, wie klimabedingte Veränderungen komplexe und nichtlineare Effekte auf fundamentale Arten haben können. Prochlorococcus ist keine einheitliche Population, sondern eine Ansammlung von Ökotypen mit unterschiedlichen Toleranzen; fortlaufende genomische und ökologische Überwachung wird entscheidend sein, um adaptive Reaktionen oder das Auftreten hitzetoleranter Stämme zu erkennen. Fortschritte bei autonomen Probenahmen, Hochdurchsatz-Sequenzierung und Fernerkundung werden die räumliche und zeitliche Abdeckung verbessern und die Unsicherheit reduzieren.
Die Erhaltung und Ausweitung von in situ Beobachtungsprogrammen, die Integration mikrobieller Physiologie in globale Klimamodelle sowie das Verfolgen von Veränderungen in der Gemeinschaftszusammensetzung werden notwendige Schritte sein, um vorherzusagen, wie marine Ökosysteme und globale biogeochemische Kreisläufe auf die anhaltende Erwärmung der Ozeane reagieren werden.
Fazit
Neue feldbasierte Messungen deuten darauf hin, dass Prochlorococcus, ein wichtiger photosynthetischer Mikroorganismus, der bei der Produktion von etwa einem Drittel des Sauerstoffs der Erde hilft, empfindlicher auf die Erwärmung der Ozeane reagieren könnte als Labordaten vermuten ließen. Optimales Wachstum wurde zwischen 19 und 28 °C beobachtet, mit deutlichen Rückgängen oberhalb von etwa 30 °C. Projektionen zur Erwärmung könnten die Produktivität von Prochlorococcus in tropischen Ozeanen erheblich verringern und sein Verbreitungsgebiet polwärts verschieben, mit möglichen Folgen für marine Nahrungsnetze und den Kohlenstoffkreislauf. Obwohl Unsicherheiten und Lücken bestehen—insbesondere hinsichtlich seltener hitzetoleranter Stämme—hebt die Studie die Bedeutung langfristiger in situ‑Beobachtungen zur Verbesserung von Projektionen über die Reaktionen von Ozeanökosystemen auf den Klimawandel hervor.
Quelle: nature

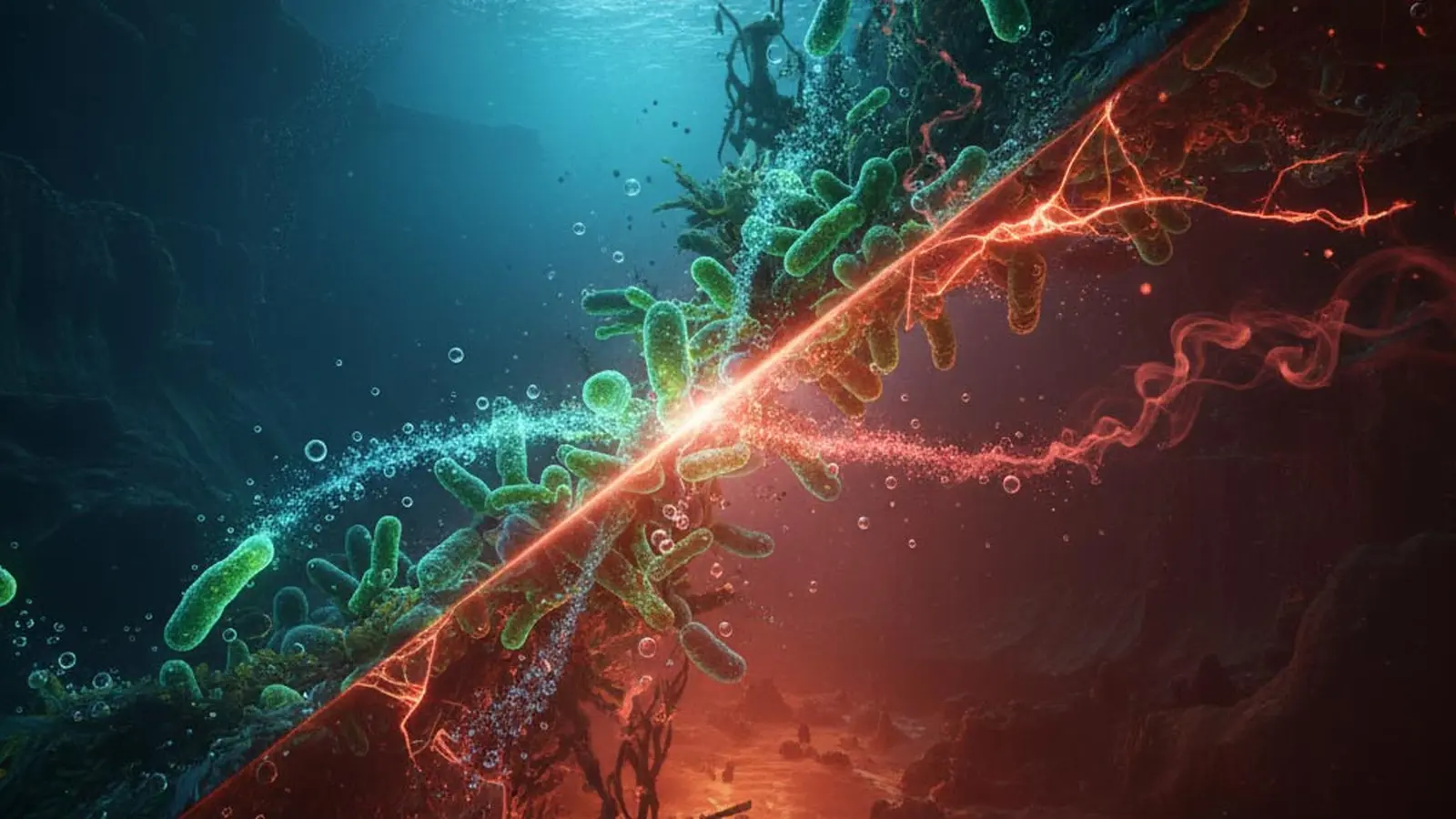
Kommentar hinterlassen