9 Minuten
Bewegung statt Pillen: Arthroseversorgung neu denken
Steife Knie, schmerzende Hüften und das knirschende Unbehagen chronischer Gelenkerkrankungen gelten oft als unvermeidbare Folgen des Älterwerdens. Neuere Evidenz und klinische Übersichtsarbeiten zeigen jedoch, dass unsere Herangehensweise an Prävention und Behandlung von Arthrose nicht immer mit dem übereinstimmt, was tatsächlich wirksam ist. Die wirksamste und am weitesten zugängliche Therapie für die Mehrheit der Betroffenen ist oft keine Tablette und kein Eingriff, sondern strukturierte Bewegung: gezielte Übungen und Physiotherapie, die auf Gelenkstabilität, Kraft und Bewegungsqualität abzielen.
In ganz unterschiedlichen Gesundheitssystemen – von Irland und dem Vereinigten Königreich über Norwegen bis in die Vereinigten Staaten – erhalten weniger als die Hälfte der Patienten mit Arthrose eine formelle Überweisung zu bewegungsbasierten Angeboten oder zur Physiotherapie durch ihren Hausarzt oder primären Versorger. Stattdessen werden häufig Behandlungen verordnet, die klinische Leitlinien nicht empfehlen, und bis zu 40 % der Patienten werden zu einer chirurgischen Beratung überwiesen, bevor konservative Maßnahmen vollständig ausgeschöpft wurden.
Warum Bewegung Gelenke schützt: Biologie kurz erklärt
Arthrose ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung. Sie betrifft bereits hunderte Millionen Menschen und wird bis zur Mitte dieses Jahrhunderts voraussichtlich deutlich zunehmen — bedingt durch eine alternde Bevölkerung, zunehmende Bewegungsarmut und steigende Übergewichts- und Adipositasraten. Ein Verständnis dafür, was Bewegung auf Gewebe- und molekularer Ebene bewirkt, hilft zu erklären, warum sie so effektiv ist.
Knorpel — das widerstandsfähige Gewebe, das die Knochenenden polstert — verfügt über keine eigene direkte Blutversorgung. Er ist auf zyklische mechanische Belastung angewiesen, um Flüssigkeit, Nährstoffe und natürliche Schmierstoffe in die Matrix hinein- und wieder herauszubewegen, ähnlich dem Zusammendrücken und Entspannen eines Schwamms. Regelmäßige Bewegung erhält die Knorpelernährung und die Oberflächenintegrität; längere Inaktivität verringert den Flüssigkeitsaustausch und stört Reparaturprozesse.
Arthrose betrifft nicht nur den Knorpel, sondern das ganze Gelenkumfeld — Synovialflüssigkeit, subchondrales Knochengewebe, Bänder, die umliegende Muskulatur und die neuronalen Bahnen, die das Bewegungsgeschehen steuern. Therapien, die mehrere dieser Elemente gleichzeitig ansprechen, erweisen sich als am nützlichsten. Bewegung leistet genau das: Sie stärkt die Muskelgruppen, die Gelenke stabilisieren, verbessert die neuromuskuläre Kontrolle, reduziert proinflammatorische Zytokine im Blutkreislauf und fördert günstigere metabolische Profile, die dem Gelenkstoffwechsel zugutekommen.
Zusätzlich zur mechanischen Belastung fördert regelmäßige körperliche Aktivität angiogene und zelluläre Signalwege, die die Gewebehomöostase unterstützen. Das Zusammenspiel aus mechanischen Reizen, verbesserter Durchblutung und veränderten Entzündungsmarkern schafft ein Milieu, in dem Erhaltungs- und Reparaturprozesse effizienter ablaufen können.
Effektive Übungsformen und Therapieansätze
Therapeutische Bewegung bei Arthrose umfasst Krafttraining (Widerstandstraining), aerobe Konditionierung, Dehn- und Mobilitätsarbeit sowie neuromuskuläres Training, das Gleichgewicht und Bewegungsqualität gezielt verbessert. Widerstandstraining baut Muskelmasse und Gelenkunterstützung wieder auf; aerobe Aktivität verbessert die kardiovaskuläre Fitness und senkt systemische Entzündungsparameter.
Ein strukturierter Trainingsplan sollte stets individuell angepasst werden: Belastungsintensität, Frequenz und Progression orientieren sich an der Funktionsebene, Schmerzreaktion und den Zielen der Person. Neben gymmbasierten oder gerätegestützten Programmen eignen sich auch einfache, alltagsnahe Übungen, die mit dem eigenen Körpergewicht oder mit elastischen Bändern durchgeführt werden können. Regelmäßigkeit und langsame Steigerung der Belastung sind entscheidend, um Anpassungen ohne Überlastung zu ermöglichen.
Neuromuskuläre Programme wie GLA:D® (Good Life with osteoArthritis: Denmark) kombinieren überwachte Gruppensitzungen durch Physiotherapeuten mit Patientenschulung und praktischem Bewegungstraining. Diese Programme legen Gewicht auf Bewegungsqualität, Gleichgewicht und graduelle Belastungssteigerung, um Gelenkstabilität und Selbstvertrauen wiederherzustellen. Zahlreiche Studien berichten über klinisch bedeutsame Schmerzlinderungen sowie Verbesserungen in Funktion und Lebensqualität, die bis zu einem Jahr nach Abschluss des Programms anhalten.
Wichtige Komponenten eines erfolgreichen Programms sind eine initiale Assessment-Phase (Beurteilung von Gelenkfunktion, Kraft und Gangbild), individuell dosierte Übungsprogression, regelmäßige Evaluationspunkte und eine klare Anleitung zur Selbstanpassung der Übungen im Alltag. Ergänzende Maßnahmen wie gezieltes Gangtraining, Treppensteigen-Übungen oder sensorisches Feedback (z. B. über Spiegel oder Videoanalyse) können die Übertragbarkeit in alltägliche Aktivitäten erhöhen.

Arthrose betrifft die gesamte Gelenkregion
Mechanismen jenseits der Mechanik: Entzündung und Stoffwechsel
Übergewicht und Adipositas erhöhen das Arthroserisiko nicht nur durch zusätzliche mechanische Belastung der Gelenke, sondern auch durch höhere Konzentrationen entzündungsfördernder Moleküle im Blut und in den Gelenkgeweben. Diese Mediatoren können den Knorpelabbau beschleunigen und die Schmerzsignalübertragung verändern. Regelmäßige körperliche Aktivität senkt proinflammatorische Marker, reduziert oxidativen Zellstress und kann sogar Genexpressionsmuster beeinflussen, die mit Gewebereparatur und Resilienz verbunden sind.
Weiters hat körperliche Aktivität positive Effekte auf Insulinsensitivität, Lipidprofile und Blutdruck — alles Faktoren, die den Gesamtgesundheitszustand verbessern und indirekt den Verlauf einer Arthrose positiv beeinflussen können. Deshalb adressiert ein bewegungsbasiertes Behandlungskonzept gleichzeitig häufige Komorbiditäten wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und depressive Verstimmungen.
Diese systemischen Effekte unterstreichen, warum rein symptomatische Therapien oft weniger wirkungsvoll sind als integrative Konzepte, die funktionelle Rehabilitation, metabolische Optimierung und psychosoziale Unterstützung kombinieren.
Klinische Konsequenzen: Erst Bewegung, dann Operation
Derzeit gibt es keine breit verfügbaren krankheitsmodifizierenden Medikamente für Arthrose, die nachweislich das Fortschreiten zuverlässig stoppen. Gelenkersatzoperationen können bei fortgeschrittener Erkrankung die Lebensqualität erheblich verbessern, sind jedoch große Eingriffe mit Risiken, Rehabilitationsbedarf und variablen Langzeitergebnissen. Leitlinienbasierte Versorgung empfiehlt für die meisten Patienten, mit konservativen Therapien zu beginnen: strukturiertes Übungsprogramm, Gewichtsmanagement bei relevantem Übergewicht, patientenorientierte Aufklärung und gezielte Physiotherapie.
Bewegung sollte früh eingeführt, an die Belastbarkeit angepasst und in allen Krankheitsstadien fortgeführt werden. Im Vergleich zu vielen pharmakologischen Optionen hat Bewegung deutlich weniger unerwünschte Nebenwirkungen und liefert breite gesundheitsfördernde Effekte. Ein konservatives Behandlungskonzept kann nicht nur Schmerzen reduzieren und Funktion verbessern, sondern auch die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen operativen Eingriffs verringern oder dessen Zeitpunkt hinauszögern.
Entscheidungen für eine Operation sollten auf umfassender konservativer Versorgung basieren und individuell nach funktionellem Bedarf, Schmerzlast sowie psychosozialen Faktoren getroffen werden. Eine dokumentierte, gut durchgeführte Phase konservativer Therapie erhöht die Erfolgsaussichten und die Patientenzufriedenheit bei späteren chirurgischen Eingriffen.
Umsetzungsbarrieren und Chancen
Warum wird Bewegung dann trotzdem so selten verordnet? Zu den Barrieren zählen die begrenzte Zeit in hausärztlichen oder primärärztlichen Konsultationen, unzureichende Ausbildung von Behandlern in der Verordnung von Übungsprogrammen, verbreitete Patientenüberzeugungen, Aktivität könne Gelenkschäden verschlimmern, sowie ungleicher Zugang zu überwachten Physiotherapieangeboten. Diese Lücken erfordern bessere Aus- und Fortbildung für Fachkräfte und Patienten, eine breitere Verfügbarkeit evidenzbasierter Gruppenkurse (wie GLA:D®), digitale Plattformen für Fernbetreuung und Anreize in der Gesundheitspolitik, konservative Versorgung vor operativen Maßnahmen zu priorisieren.
Technologische Hilfsmittel – tragbare Sensoren, Tele-Rehabilitationsplattformen und App-basierte Übungsmodule – erleichtern die Individualisierung von Belastungsprogression und das Monitoring der Therapietreue. Solche digitalen Lösungen bieten skalierbare Wege, qualitativ hochwertige Bewegungsinterventionen einem größeren Patientenkreis zugänglich zu machen. Wichtig ist jedoch, dass digitale Angebote evidenzbasiert konzipiert, in klinische Pfade integriert und durch qualifiziertes Fachpersonal begleitet werden.
Darüber hinaus können Versorgungsmodelle, die interdisziplinäre Teams einbinden — Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Ernährungsberater und Psychologen — die Behandlung ganzheitlicher gestalten. Finanzielle und organisatorische Anreize, beispielsweise Vergütungsmodelle, die konservative Versorgungsphasen honorieren, wären ein weiterer Hebel, um die Implementation zu beschleunigen.
Patientenschulungen zur Förderung von Eigenmanagement, Umgang mit Belastungsschmerzen und zur langfristigen Integration von Übungen in den Alltag sind zentrale Bestandteile einer nachhaltigen Versorgung. Peer-Support-Gruppen und Community-basierte Angebote können Motivation und Adhärenz zusätzlich stärken.
Experteneinschätzung
„Bewegung ist das am meisten unterschätzte Medikament bei Arthrose“, sagt Dr. Elena Morris, klinische Physiotherapeutin und Forscherin mit Schwerpunkt muskuloskelettale Rehabilitation. „Wenn wir Patientinnen und Patienten beibringen, sich effektiv zu bewegen, und progressive Widerstands- sowie Gleichgewichtsarbeit verordnen, sehen wir nicht nur Schmerzlinderung, sondern echte Fortschritte in Funktion und Selbstvertrauen. Die Herausforderung besteht darin, überwachte, evidenzbasierte Programme zugänglich zu machen und sie in routinemäßige primärärztliche Versorgungswege zu integrieren.“
Fachleute betonen außerdem, dass die Kommunikation über Erwartungen, Schmerzmanagement und realistische Zielsetzungen essenziell ist. Die Integration klarer Messgrößen für Funktion und Lebensqualität — etwa Gehstrecke, Aufstehen-aus-dem-Stuhl-Tests oder patientenberichtete Outcome-Parameter — unterstützt die Nachverfolgbarkeit und Qualität der Versorgung.
Praktische Hinweise für Patientinnen und Patienten
Für Betroffene empfiehlt sich eine schrittweise Herangehensweise: beginnen Sie mit niedrig dosierten, regelmäßigen Übungen, beachten Sie die Schmerzreaktion (zwischen moderatem bis tolerierbarem Schmerzwert bleibt oft funktionell sinnvoll) und steigern Sie Belastung und Intensität langsam. Übungen sollten mehrere Komponenten umfassen: Kraft (z. B. Squats mit Körpergewicht, Beinpressen oder Widerstandsbänder), Ausdauer (z. B. zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen), Mobilität und Gleichgewicht.
Gute Betreuung umfasst eine initiale Bewegungsanalyse, individualisierte Übungspläne, regelmäßige Überprüfungen und Selbstmanagement-Strategien für Rückfälle. Patientinnen und Patienten sollten ermutigt werden, Ziele festzulegen, Fortschritte zu dokumentieren und bei Bedarf Unterstützung von Physiotherapeutinnen und -therapeuten zu suchen.
Schlussbemerkung
Arthrose ist nicht einfach unvermeidlicher Verschleiß. Es handelt sich um eine multifaktorielle, das gesamte Gelenk betreffende Erkrankung, die von Muskelkraft, Entzündung, metabolischem Status und Bewegungsgeschichte geprägt wird. Regelmäßige, gezielte Bewegung adressiert viele dieser Treiber gleichzeitig — sie nährt Knorpel durch geeignete Belastung, stellt muskuläre Unterstützung wieder her, verbessert die neuromuskuläre Kontrolle und verringert systemische Entzündungsprozesse. Für die meisten Patientinnen und Patienten sollte bewegungsbasierte Therapie die Erstlinie sein und über den gesamten Krankheitsverlauf fortgeführt werden; Operationen bleiben vorbehalten für Fälle, die auf umfassende konservative Versorgung nicht ausreichend ansprechen. Die Verankerung von Bewegung als Standardpraxis erfordert Aus- und Weiterbildung der Behandler, Patientenschulung und breiteren Zugang zu überwachten Programmen, doch die potenziellen Vorteile für Individuen und Gesundheitssysteme sind beträchtlich.
Zusammengefasst: Ein Paradigmenwechsel hin zu mehr Bewegung, gezielter Physiotherapie und systemischer Integration konservativer Maßnahmen kann die Behandlungsergebnisse bei Arthrose nachhaltig verbessern und die Belastung durch operative Eingriffe reduzieren. Politik, Gesundheitsdienstleister und Forschung sind aufgefordert, gemeinsam Strukturen zu schaffen, die Bewegungsbasierte Versorgungsmodelle effektiv, zugänglich und skalierbar machen.
Quelle: sciencealert

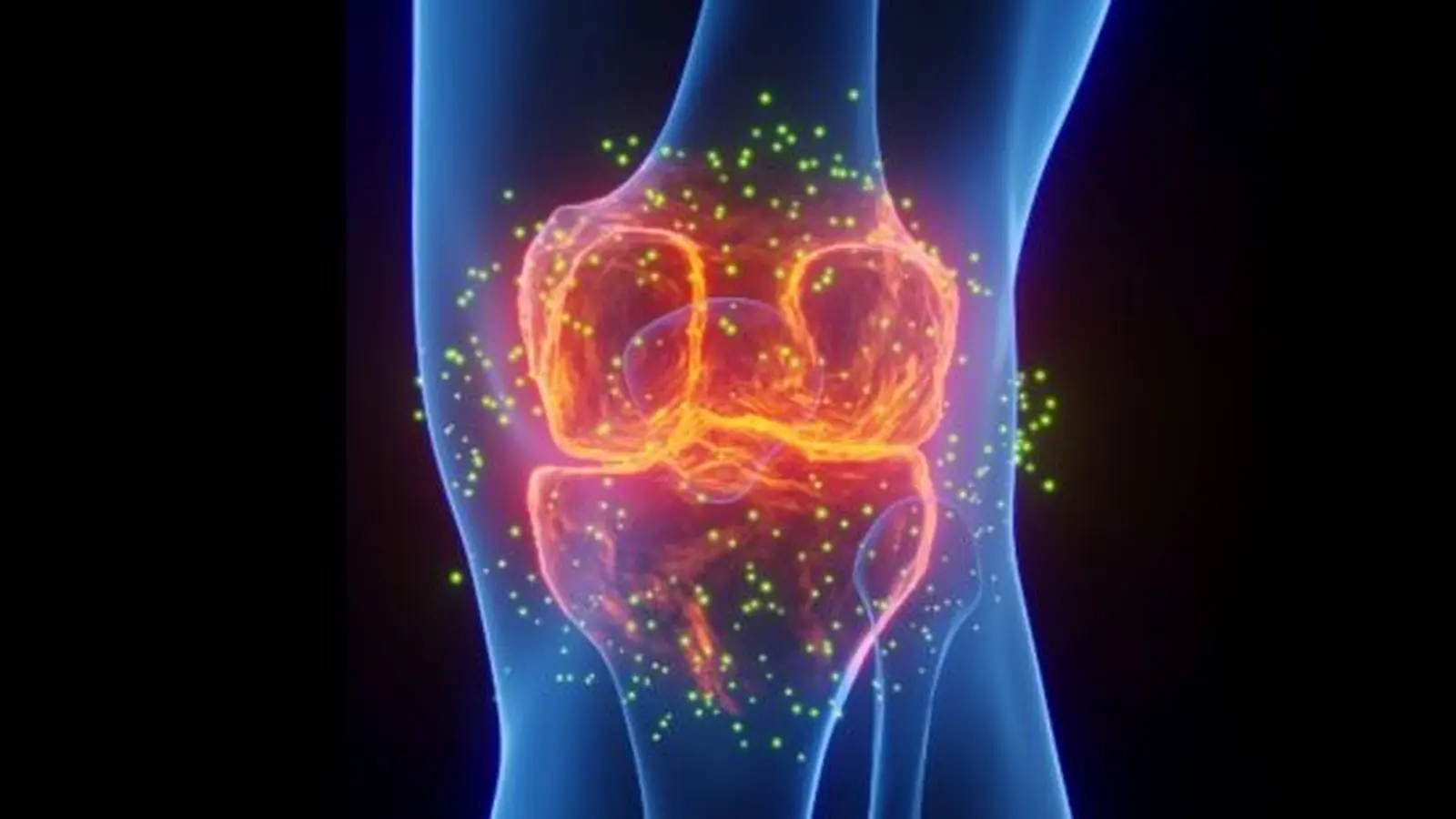
Kommentar hinterlassen