4 Minuten
Forscher der Stanford Medicine berichten, dass übermäßige Aktivität im retikulären Thalamuskern (RTN) Verhaltensweisen fördern kann, die mit Autismus-Spektrum-Störungen in einem Mausmodell verknüpft sind. Mithilfe experimenteller Pharmakologie und gezielter Neuromodulation unterdrückte das Team die Hyperaktivität in dieser für die sensorische Filterung wichtigen Hirnregion und kehrte mehrere autismusähnliche Merkmale bei Mäusen um, darunter Anfälle, sensorische Überreaktivität, repetitives Verhalten, Hyperaktivität und verringerte soziale Interaktionen. Bildnachweis: Shutterstock
Wissenschaftlicher Hintergrund
Thalamus und Cortex bilden eine zentrale sensorische Relaisstation, die beeinflusst, wie das Gehirn äußere Reize interpretiert. Der RTN ist ein kleiner inhibitorischer Kern, der Signale zwischen Thalamus und Cortex schottet und so Aufmerksamkeit und sensorische Filterung reguliert. Frühere klinische und tierexperimentelle Studien haben thalamokortikale Schaltkreise mit Autismus in Verbindung gebracht, doch die spezifische Rolle des RTN blieb unklar. Mithilfe eines genetischen Mausmodells ohne das Cntnap2-Gen untersuchten die Forschenden die neuronalen Dynamiken im RTN und korrelierten diese mit Verhaltensmustern, um herauszufinden, wie lokale Aktivitätsänderungen zu autismusähnlichen Phänotypen führen.
Experimentelle Details und Methoden
Aufzeichnung und Verhaltenskorrelation
Das Team zeichnete die Feuerraten von RTN-Neuronen in frei beweglichen Mäusen auf und setzte die Aktivitätsmuster in Beziehung zu Reaktionen auf visuelle und taktile Reize sowie zu sozialen Interaktionen. Bei Cntnap2-Knockout-Mäusen zeigten RTN-Neurone ungewöhnlich hohe Basis- und reizinduzierte Feuerraten sowie spontane Burst‑Aktivitäten, die mitunter Anfälle auslösten.
Interventionen: Arznei und DREADD‑Neuromodulation
Um Kausalität zu prüfen, setzten die Forschenden zwei komplementäre Interventionen ein. Zunächst verabreichten sie das experimentelle Antiepileptikum Z944, das die Erregbarkeit des RTN reduziert; die Behandlung normalisierte die neuronale Aktivität und beseitigte Verhaltensdefizite. Anschließend nutzten sie eine chemogenetische Neuromodulation auf DREADD‑Basis, um RTN‑Neurone selektiv zu unterdrücken oder zu aktivieren. Die Unterdrückung der RTN‑Hyperaktivität kehrte die autismusähnlichen Verhaltensweisen im Modell um, während eine künstliche Erhöhung der RTN‑Feuerrate in gesunden Mäusen ähnliche Verhaltensänderungen hervorrief — ein Beleg für bidirektionale Kontrolle.

Wesentliche Erkenntnisse und Implikationen
Die in Science Advances veröffentlichte Studie unter Leitung des Seniorautors John Huguenard und Erstautors Sung‑Soo Jang zeigt, dass RTN‑Hyperaktivität ausreichen kann, um ein Bündel autismusrelevanter Symptome bei Mäusen hervorzurufen. Die Ergebnisse heben auch überlappende Mechanismen zwischen Autismus und Epilepsie hervor: Die Anfallsanfälligkeit ist bei Menschen im Autismus‑Spektrum deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung, und Z944 sowie verwandte Verbindungen werden derzeit als mögliche Epilepsie‑Therapien untersucht. Eine gezielte Modulation von RTN‑Schaltkreisen könnte daher die doppelte Chance bieten, sowohl Anfälle als auch Kernsymptome des Verhaltens bei bestimmten Patientengruppen zu reduzieren.
Zugehörige Technologien und zukünftige Perspektiven
Die Arbeit veranschaulicht, wie zielgerichtete Neuromodulation — pharmakologisch oder rezeptorbasiert (DREADD) — Schaltungsdysfunktionen untersuchen und umkehren kann. Die Übertragung dieser Ergebnisse auf den Menschen erfordert Sicherheitstests, die Identifizierung von Patientengruppen mit RTN‑verbundener Pathophysiologie und die Entwicklung klinisch einsetzbarer Modulatoren oder Neuromodulationsansätze, etwa fokussierte Hirnstimulation oder selektive Pharmakologie.
Experteneinschätzung
Dr. Maria Alvarez, Neurowissenschaftlerin mit Spezialisierung auf Schaltungsstörungen, kommentiert: "Diese Studie ist ein wichtiger Proof of Principle. Sie reduziert ein komplexes Problem — die Verhaltensvielfalt beim Autismus — auf einen manipulierbaren Schaltungs-Knotenpunkt. Zwar sind Mäuse keine Menschen, doch die Rolle des RTN in der sensorischen Filterung macht ihn zu einem vielversprechenden therapeutischen Ziel für weiterführende translationale Forschung."
Fazit
Die Stanford‑Studie identifiziert den retikulären Thalamuskern als neuen Schaltungsort, dessen Hyperaktivität autismusähnliche Verhaltensweisen bei Mäusen erzeugt. Durch die Rückführung dieser Hyperaktivität mit einem experimentellen Antikonvulsivum und mit chemogenetischer Neuromodulation konnten die Forschenden mehrere Verhaltensdefizite rückgängig machen — ein Befund, der eine gemeinsame neurobiologische Verbindung zwischen Autismus und Epilepsie unterstreicht und neue Richtungen für gezielte Therapien aufzeigt.
Quelle: scitechdaily

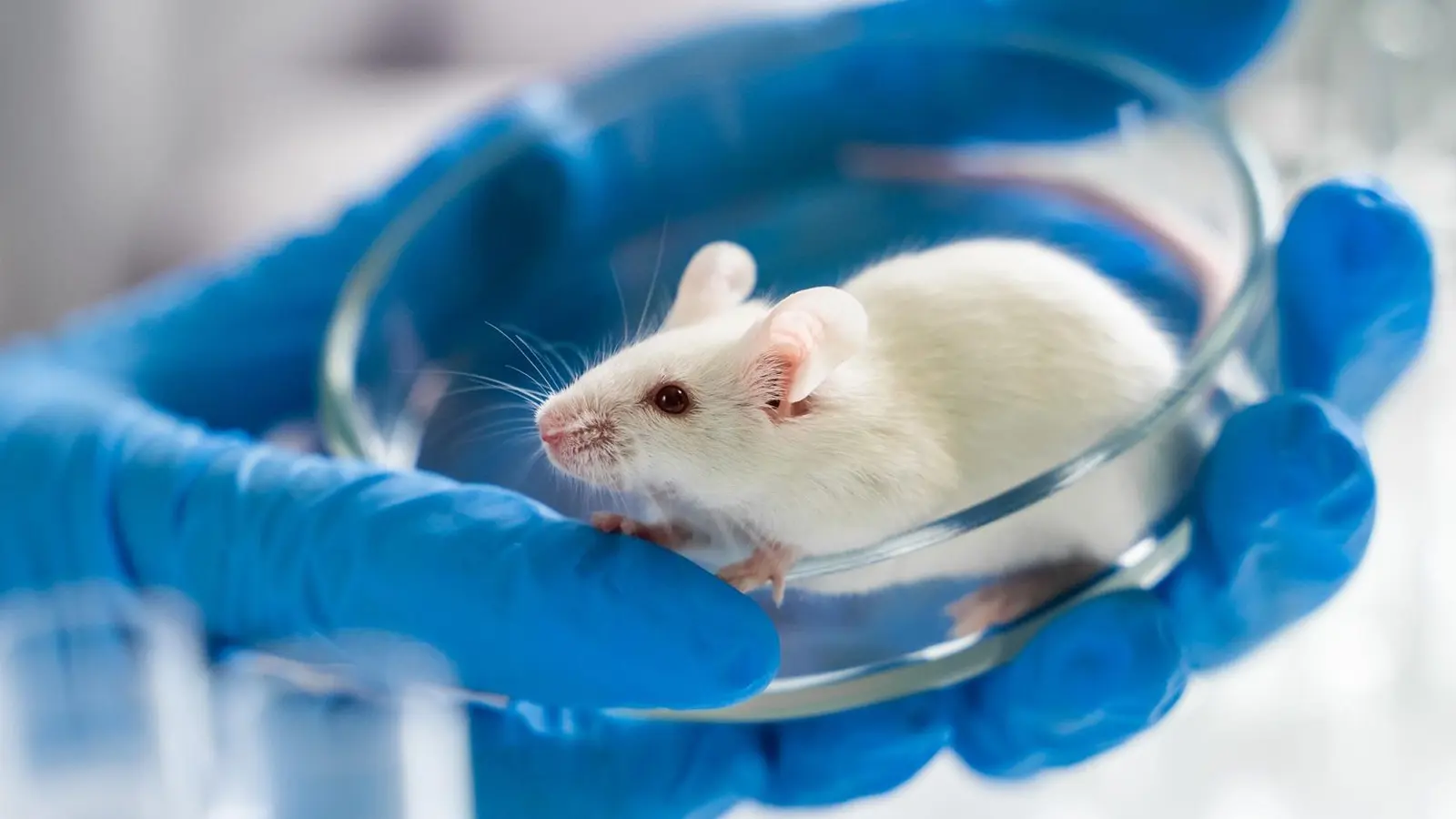
Kommentar hinterlassen