7 Minuten
Zusammenfassung und wichtigste Erkenntnis
Der Cannabiskonsum wurde in einer großen retrospektiven Analyse elektronischer Gesundheitsakten mit einem deutlich erhöhten Risiko für die Entwicklung von Diabetes in Verbindung gebracht. Die auf der Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2025 in Wien vorgestellte Studie berichtet, dass Menschen mit einer cannabisbezogenen Diagnose über einen fünfjährigen Follow-up-Zeitraum fast viermal häufiger eine neue Diabetesdiagnose erhielten als gematchte Personen ohne Substanzgebrauchshistorie oder schwere chronische Erkrankungen.
Studiendesign und Datenquellen
Forscher unter der Leitung von Dr. Ibrahim Kamel am Boston Medical Center analysierten reale klinische Datensätze, die im TriNetX Research Network zusammengeführt sind, einer föderierten elektronischen Gesundheitsaktenplattform (EHR), die Daten mehrerer Gesundheitseinrichtungen in den USA und Europa verknüpft. Das Team identifizierte 96.795 ambulante Patientinnen und Patienten im Alter von 18 bis 50 Jahren, bei denen zwischen 2010 und 2018 ein cannabisbezogener Diagnoseschlüssel dokumentiert wurde. Cannabisdiagnosen reichten von gelegentlichem Konsum und Intoxikation bis hin zu Abhängigkeit und Entzug.
Um eine Vergleichskohorte zu erstellen, verwendeten die Forschenden Propensity-Score-Matching, um die Cannabis-Gruppe mit 4.160.998 Personen zu paaren, die bei Studienbeginn keine aufgezeichnete Vorgeschichte von Substanzgebrauchsstörung oder schwerer chronischer Erkrankung hatten. Zu den Matching-Variablen zählten Alter, Geschlecht und vorbestehende Komorbiditäten. Alle Teilnehmenden wurden bis zu fünf Jahre nachverfolgt, um neu aufgetretene Diabetesdiagnosen in den EHRs zu erfassen.
Ergebnisse, Anpassungen und statistische Befunde
Während des Follow-ups entwickelten 1.937 Personen (2,2 %) in der cannabisdiagnostizierten Kohorte Diabetes, verglichen mit 518 Personen (0,6 %) in der gematchten Kontrollkohorte. Nach Anpassung für etablierte kardiometabolische Risikofaktoren wie HDL- und LDL-Cholesterin, unkontrollierten Blutdruck, arteriosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für gleichzeitigen Substanzgebrauch einschließlich Kokain und Alkohol blieb die Exposition gegenüber Cannabis stark mit neu auftretendem Diabetes assoziiert. Die adjustierten Analysen zeigten einen fast vierfach höheren relativen Anstieg an Diabetesdiagnosen in der Cannabis-Gruppe im Vergleich zu den Kontrollen.

Die Forschenden nutzten multiple Regressionsmodelle und Methoden des Propensity Scorings, um Confounding zu reduzieren, räumen jedoch ein, dass Restkonfoundierung möglich ist und retrospektive EHR-Studien keine Kausalität nachweisen können. Dennoch sind das Ausmaß und die Konsistenz der Assoziation über die adjustierten Modelle hinweg bemerkenswert und werfen Fragen zu möglichen metabolischen Effekten des Cannabiskonsums auf.
Mögliche biologische Mechanismen
Die Autorinnen und Autoren sowie unabhängige Kommentatoren haben mehrere biologische und verhaltensbezogene Mechanismen vorgeschlagen, die den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und erhöhtem Diabetesrisiko erklären könnten. Eine Hypothese betrifft Veränderungen der Insulinsensitivität: Cannabinoide interagieren mit dem endocannabinoiden System, das eine Rolle bei Appetitregulation, Energiebalance und Glukosestoffwechsel spielt. Chronische Aktivierung oder Dysregulation dieses Systems könnte bei anfälligen Personen zur Insulinresistenz beitragen.
Auch Verhaltens- und Lebensstilpfade dürften eine Rolle spielen. Cannabiskonsum wurde in einigen Studien mit veränderten Ernährungsgewohnheiten, erhöhtem Kalorienkonsum und unregelmäßigen Bewegungsmustern in Verbindung gebracht – Faktoren, die Gewichtszunahme und metabolische Gesundheit beeinflussen können. Die vorliegende Analyse enthielt keine detaillierten Messungen zu Verläufen des Body-Mass-Index (BMI), zur Ernährung oder zur körperlichen Aktivität, sodass die Abgrenzung direkter physiologischer Effekte von lifestyle-vermittelten Effekten offen bleibt.
Öffentliche Gesundheitsimplikationen und klinische Empfehlungen
Mit der zunehmenden Legalisierung und sozialen Akzeptanz von Cannabis weltweit haben die Studienergebnisse unmittelbare Bedeutung für Klinikerinnen und Kliniker, Fachkräfte im öffentlichen Gesundheitswesen und politische Entscheidungsträger. Der leitende Forscher Dr. Kamel betonte die Notwendigkeit, metabolische Risikobewertungen in Pfade der Patientenversorgung für Personen, die Cannabis konsumieren, zu integrieren. Routinemäßiges Screening von Blutzucker, HbA1c und anderen metabolischen Parametern kann sinnvoll sein, wenn Patientinnen oder Patienten regelmäßigen Cannabiskonsum angeben oder eine cannabisbezogene Diagnose in der Krankenakte erscheint.
Öffentliche Gesundheitsbotschaften sollten bekannte und vermutete Risiken gegen potenzielle therapeutische Anwendungen von Cannabis und Cannabinoidverbindungen abwägen. Die Autorinnen und Autoren fordern eine bessere Patientenaufklärung über metabolische Überwachung und die Integration des Diabetesrisikos in Behandlungs- und Beratungsangebote für Substanzgebrauchsstörungen.
Beschränkungen und offene Fragen
Trotz Größe und Umfang des Datensatzes hat die Studie mehrere Einschränkungen, die die Interpretation beeinflussen. Wichtige Einschränkungen umfassen:
Fehlende detaillierte Expositionsdaten
In elektronischen Gesundheitsakten werden typischerweise Diagnoseschlüssel erfasst, nicht jedoch präzise Konsummuster. Die Analyse konnte nicht zuverlässig zwischen Gebrauchshäufigkeit (gelegentlich vs. täglich), Verabreichungswegen (inhalierter Rauch/Dampf vs. Nahrungsmittel), Potenz (THC-Konzentration) oder Nutzungsdauer unterscheiden. Diese Variablen könnten die metabolischen Ergebnisse wesentlich beeinflussen.
Mögliche Fehlklassifikation und Meldungssystematik
Der Cannabiskonsum kann in klinischen Kontexten untererfasst sein, insbesondere in Regionen, in denen Besitz weiterhin illegal ist. Fehlklassifikation der Exposition und inkonsistente Dokumentation zwischen Einrichtungen können Verzerrungen einführen. Die Forschenden versuchten, Verzerrungen durch Propensity-Score-Matching und Anpassung für gemessene Störfaktoren zu reduzieren, doch unbeobachtete Faktoren wie sozioökonomischer Status, präzise BMI-Trends, Ernährungsqualität und Aktivitätsniveau könnten die Ergebnisse beeinflusst haben.
Retrospektives Design
Da die Studie beobachtend und retrospektiv ist, kann sie keine Kausalität nachweisen. Die Autorinnen und Autoren warnen ausdrücklich, dass die beobachtete Assoziation keinen definitiven Beweis darstellt, dass Cannabis Diabetes verursacht; vielmehr handelt es sich um eine klinisch relevante Korrelation, die prospektive Untersuchungen rechtfertigt.
Experteneinschätzung
Dr. Maria R. Jensen, Endokrinologin und Associate Professor of Medicine an einem großen akademischen Zentrum, bietet eine einordnende Perspektive: "Dies ist ein robustes, groß angelegtes Signal, das Klinikerinnen und Kliniker sowie Forschende dazu anregen sollte, metabolische Ergebnisse bei Patientinnen und Patienten, die Cannabis nutzen, genauer zu beobachten. Die biologische Plausibilität ist gegeben – die endocannabinoide Signalgebung überschneidet sich mit Pfaden, die Appetit und Insulinsensitivität steuern – aber wir brauchen prospektive Kohortenstudien und mechanistische Studien, um Kausalität zu klären und zu bestimmen, welche Cannabisformen, falls überhaupt, am riskantesten sind." Sie ergänzt: "Praktisch sollten Ärztinnen und Ärzte routinemäßig nach Cannabiskonsum fragen und bei positivem Konsum ein Basis- und wiederkehrendes metabolisches Screening in Erwägung ziehen."
Nächste Schritte für Forschung und Überwachung
Um diese Erkenntnisse in sichere klinische Praktiken und klarere öffentliche Gesundheitsstrategien zu überführen, ergeben sich mehrere Forschungsprioritäten:
- Prospektive Kohortenstudien, die detaillierte Expositionsmaße erfassen (Häufigkeit, Darreichungsform, Potenz) sowie objektive metabolische Endpunkte (Nüchternblutzucker, HbA1c, Insulinresistenz-Indizes).
- Kontrollierte mechanistische Studien, die untersuchen, wie Cannabinoide die Insulinsignalgebung, die Funktion der Pankreas-Beta-Zellen und systemische Entzündungsprozesse beeinflussen.
- Stratifizierte Analysen, um zu bestimmen, ob das Risiko nach Alter, Geschlecht, Ausgangs-BMI, genetischer Veranlagung und gleichzeitigem Substanzgebrauch variiert.
- Forschung im Bereich Gesundheitsversorgung, um Screening-Protokolle und Beratungsinterventionen für Gesundheitssysteme in Regionen mit legalisierten Cannabismärkten zu entwickeln.
Die EASD-Tagung in Wien bietet ein internationales Forum für diese multidisziplinären Gespräche. Präsentationen unter Nutzung großer föderierter EHR-Netzwerke wie TriNetX zeigen, wie Real-World-Evidence schnell aufkommende gesundheitliche Risiken aufdecken kann, weisen aber zugleich auf den Bedarf an ergänzenden prospektiven und experimentellen Studien hin.
Schlussfolgerung
Diese große retrospektive Analyse, die cannabisbezogene Diagnosen mit einer erhöhten Inzidenz von Diabetes verknüpft, fügt den laufenden Debatten über Cannabis-Sicherheit und Gesundheitspolitik eine wichtige Dimension hinzu. Die Assoziation – in den adjustierten Analysen nahezu eine vierfache Risikoerhöhung – beweist keine Kausalität, signalisiert jedoch klaren Forschungsbedarf, die Notwendigkeit routinemäßiger metabolischer Überwachung in der klinischen Praxis, wo angebracht, sowie ausgewogene öffentliche Gesundheitsbotschaften. Zukünftige prospektive und mechanistische Studien sollten klären, welche Konsummuster oder Präparate, falls vorhanden, das metabolische Risiko erhöhen, und effektive Strategien zur Prävention und Früherkennung von Diabetes bei Personen mit Cannabiskonsum identifizieren.
Quelle: scitechdaily

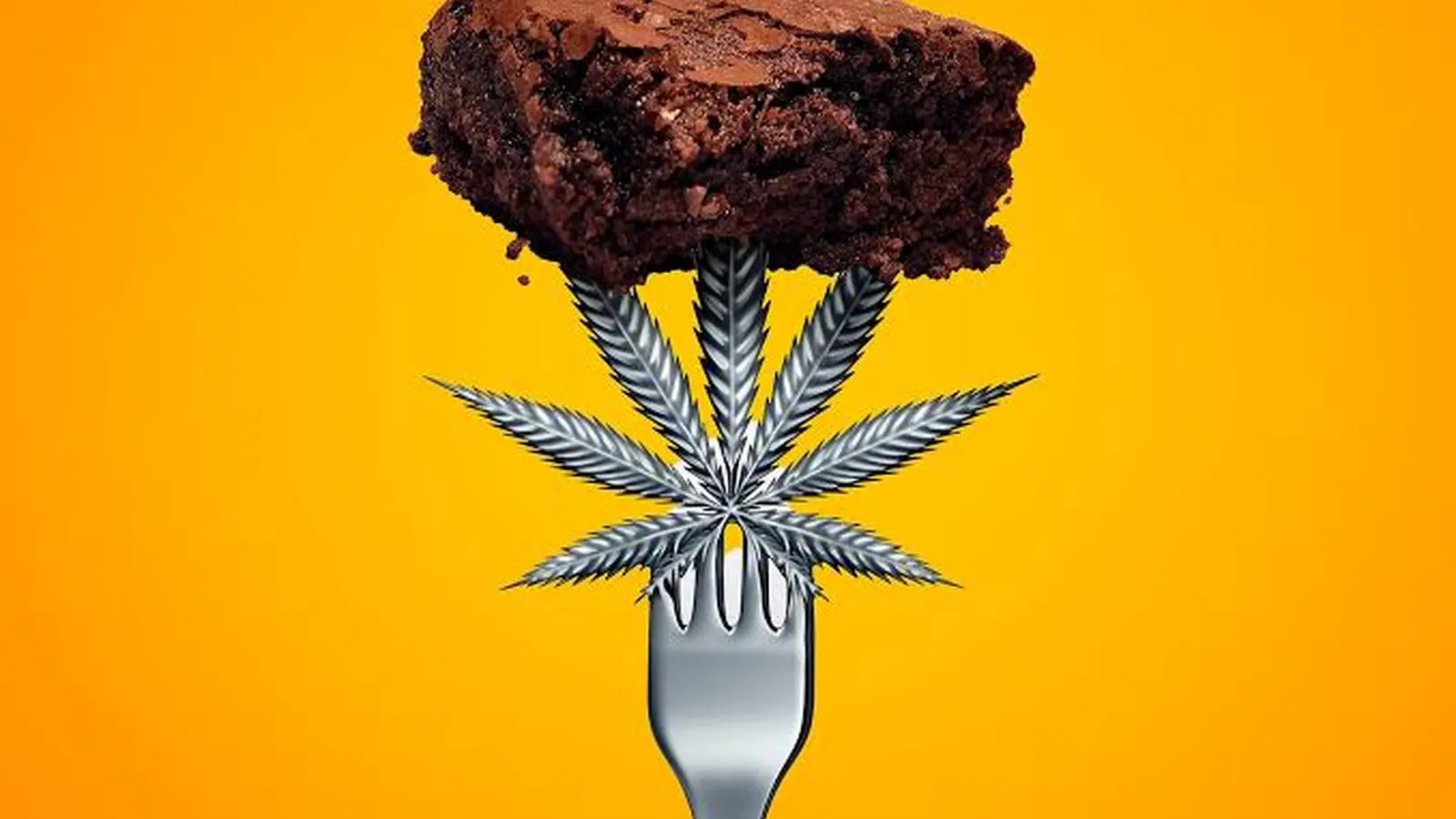
Kommentar hinterlassen