8 Minuten
Eine neue kontrollierte Studie stellt die pauschale Annahme infrage, dass alle verarbeiteten festen Fette automatisch schädlich für die kardiovaskuläre Gesundheit sind. Forscher prüften zwei gängige industrielle Fette – interestifizierte Fette, die reich an Palmitinsäure oder Stearinsäure sind – wie sie in Margarinen, Gebäck und Aufstrichen verwendet werden, und fanden keine messbaren schädlichen Effekte auf wichtige Herz-Kreislauf-Risikomarker bei typischer Nahrungsaufnahme.
Eine kontrollierte Studie zeigte, dass interestifizierte Fette bei normalem Verzehr keine negativen Effekte auf zentrale Herzgesundheitsmarker haben. Quelle: Stock
Was die Studie untersuchte und warum das relevant ist
Die Forschung, geleitet von Teams des King’s College London und der Maastricht University und veröffentlicht im American Journal of Clinical Nutrition, untersuchte, ob interestifizierte (IE) Fette, die industriell als Ersatz für Transfettsäuren und manche tierische Fette eingesetzt werden, kurzfristige Marker der kardiometabolischen Gesundheit verändern. Die Interestifizierung ist ein Verarbeitungsverfahren, das Fettsäuren an das Glycerolgerüst umsetzt oder neu verteilt, um feste oder halb-feste Fette herzustellen, ohne dabei trans-Fettsäuren zu erzeugen.
Die Frage nach den gesundheitlichen Auswirkungen dieser Fette ist wichtig, weil Lebensmittelhersteller zunehmend interestifizierte Fette in Margarinen, Backwaren, Gebäck und Süßwaren verwenden, während sie Produkte umformulieren, um den Gehalt an transfettsäuren zu reduzieren oder das Profil gesättigter Fettsäuren zu verändern. Öffentliche Bedenken gegenüber verarbeiteten Lebensmitteln haben die Transparenz über solche Zutaten für Regulierungsbehörden, Fachleute und Konsumenten zur Priorität gemacht.
Interesterifizierte Fette werden häufig eingesetzt, um technologische Eigenschaften wie Schmelzverhalten, Textur und Stabilität zu erreichen. Gleichzeitig stehen Fragen zu Cholesterin, Lipidstoffwechsel und Entzündungsmarkern im Mittelpunkt der ernährungswissenschaftlichen Debatte. Die Studie liefert Daten, die helfen, die Unterschiede zwischen verschiedenen Arten verarbeiteter Fette, ihren chemischen Eigenschaften und potenziellen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-Risiko klarer zu fassen.
Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es wichtig, zwischen verschiedenen Subtypen gesättigter Fettsäuren zu unterscheiden: Palmitinsäure (16:0) und Stearinsäure (18:0) haben ähnliche chemische Grundzüge, zeigen aber in metabolischer Hinsicht unterschiedliche Effekte. Darüber hinaus beeinflusst die Position der Fettsäuren auf dem Glycerolrückgrat (z. B. sn-1, sn-2, sn-3) nach Interestifizierung das Verdauungs- und Absorptionsverhalten in unterschiedlichem Maße. Diese mechanistischen Aspekte erklären, warum experimentelle Studien erforderlich sind, um hypothetische Risiken zu prüfen.

Wie die Studie durchgeführt wurde
Die Studie rekrutierte 47 gesunde Erwachsene in einem doppelt verblindeten, randomisierten Crossover-Design. Die Teilnehmenden folgten zwei unterschiedlichen Sechswochen-Diäten, getrennt durch eine Washout-Phase. Jede Diät lieferte etwa 10 % der täglichen Energie aus den Testfetten, eingearbeitet in alltägliche Lebensmittel wie Muffins, Brotaufstriche und Backwaren. Weder die Teilnehmenden noch die Forschenden wussten, welches Fett in welchem Zeitraum konsumiert wurde.
Das Crossover-Design erhöht die statistische Power bei moderater Stichprobengröße, weil jede Person als eigene Kontrolle fungiert. Diese Methodik reduziert Variabilität durch zwischenindividuelle Unterschiede und ist bei Ernährungsinterventionen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten gut etabliert. Die sechs Wochen pro Diät wurden gewählt, um ausreichend Zeit zu bieten, damit Blutlipide und andere kardiometabolische Marker auf Ernährungsumstellungen reagieren können.
Die Untersucher maßen ein breites Spektrum an kardiometabolischen Endpunkten: Gesamtcholesterin und HDL-Cholesterin, Triglyceride, das Gesamt-zu-HDL-Cholesterin-Verhältnis (ein häufig genutzter Indikator für kardiovaskuläres Risiko), Insulinsensitivität, Entzündungsmarker (z. B. CRP), Leberfett sowie Gefäßfunktionen einschließlich endothelialer Funktion. Diese Parameter sind Standardmessgrößen in klinischen Studien, um kurzfristige Veränderungen des Herz-Kreislauf-Risikos zu detektieren.
Zusätzlich zu den Blutwerten und bildgebenden Verfahren wurden diätetische Compliance, Energiezufuhr und körperliche Aktivität kontrolliert bzw. erfasst, um Confounder auszuschließen. Solche methodischen Kontrollmaßnahmen sind wichtig, um mögliche Störfaktoren wie unterschiedliche Kalorienaufnahme, Bewegungsverhalten oder unerwünschte Änderungen anderer Nährstoffzufuhr (z. B. veränderte Aufnahme von mehrfach ungesättigten Fettsäuren) zu minimieren.
Die Auswahl von Lebensmitteln als Träger der Testfette spiegelt die reale Ernährungsaufnahme wider und erhöht damit die ökologische Validität: das heißt, die Ergebnisse sind relevanter für die Fragestellung, ob interestifizierte Fette in Alltagsprodukten auf Populationsebene kurzfristig Risiken erhöhen.
Wesentliche Ergebnisse: Keine kurzfristigen Schäden festgestellt
Die Studie fand keine signifikanten Unterschiede zwischen den palmitinsäurereichen und den stearinsäurereichen interestifizierten Fetten über die gemessenen Parameter hinweg. Die Blutlipidprofile, einschließlich Gesamtcholesterin, HDL und Triglyceride, blieben statistisch vergleichbar zwischen den Diäten.
Ebenso berichteten die Forschenden über keine nachteiligen Effekte hinsichtlich Entzündungsmarkern, Insulinresistenz, Leberfettansammlung oder Gefäßfunktionen während der sechs Wochen pro Interventionsperiode. Diese Ergebnisse legen nahe, dass bei moderatem Verzehr in einer ausgewogenen Kost kurzfristige Veränderungen wichtiger Herz-Kreislauf-Risikomarker nicht auftreten.
Die leitenden Forschenden werteten die Resultate als beruhigend für die Verbraucheranwendung dieser industriell verarbeiteten Fette in realistischen Mengen. Professorin Wendy Hall vom King’s College London merkte an, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass diese interestifizierten Fette bei üblichen Verzehrmengen wahrscheinlich kein Risiko für die kardiovaskuläre Gesundheit darstellen. Professorin Sarah Berry ergänzte, dass Interestifizierung dazu beitragen kann, harte Fette ohne die Bildung schädlicher Transfette herzustellen und möglicherweise die Reformulierung von Produkten zur Reduktion gesättigter Fettsäuren unterstützen kann.
Aus klinischer Perspektive ist es wichtig zu erkennen, dass kurzfristige Biomarker wie Cholesterin und Entzündungswerte nur ein Teil des Gesamtbilds sind. Dennoch liefern solche Interventionen wertvolle Hinweise darauf, ob eine bestimmte Verarbeitungsart akute schädliche Wirkungen hervorruft, bevor groß angelegte epidemiologische Studien abgeschlossen sind.
Die Befunde tragen zur Differenzierung zwischen verschiedenen Verarbeitungsprozessen bei: Während historische Daten Transfette klar mit erhöhtem koronaren Risiko verknüpfen, ist die Evidenzlage für andere industrielle Techniken wie Interestifizierung bislang weniger eindeutig. Diese Studie füllt eine wichtige Lücke und unterstützt die nuancierte Betrachtung von „verarbeiteten Fetten“ in Ernährungsleitlinien und Produktstrategien.
Begrenzungen und nächste Schritte
Die Studiendauer — sechs Wochen pro Diät — ist ausreichend, um Veränderungen bei Cholesterin und vielen kardiometabolischen Biomarkern nachzuweisen, aber sie adressiert nicht die langfristigen klinischen Endpunkte wie koronare Herzkrankheit über Jahre oder Jahrzehnte. Langzeitfolgen, kumulative Effekte und mögliche Interaktionen mit anderen Ernährungsfaktoren bleiben offen.
Die Untersuchung wurde an gesunden Erwachsenen durchgeführt, daher sind weitere Studien bei älteren Personen, Menschen mit bestehender metabolischer Erkrankung (z. B. Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom) oder hoher kardiovaskulärer Belastung notwendig. Unterschiede in der metabolischen Reaktion könnten bei vulnerablen Gruppen stärker ausgeprägt sein.
Längere und größere randomisierte Studien sowie kohortenbasierte epidemiologische Analysen sind erforderlich, um subtile oder kumulative Effekte chronischen Konsums zu identifizieren. Zusätzlich wären mechanistische Studien nützlich, die den Einfluss der Fettsäurepositionierung (Regioisomerie) nach Interestifizierung auf Fettverdauung, Chylomikronenbildung und Leberstoffwechsel detaillierter untersuchen.
Regulatorisch und aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ist die Nuancierung zentral: Nicht alle verarbeiteten Fette haben das gleiche Risikoprofil. Während Transfettsäuren konsistent mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko assoziiert sind und deshalb international weitgehend eingeschränkt wurden, scheinen interestifizierte palmitinsäure- und stearinsäure-reiche Fette bei realistischer Aufnahme kurzfristig keine gleichen negativen Effekte zu zeigen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keinen Grund für Vorsicht gibt — vor allem nicht bei langfristiger, hoher Aufnahme oder bei populationsspezifischen Risiken.
Als nächste Schritte schlagen die Autorinnen und Autoren der Studie vor: größere, längerdauernde Interventionen, Untersuchungen in Hochrisikopopulationen, sowie kombinierte Ansätze mit epidemiologischen Datenbanken, um Konsummuster und Langzeitoutcomes zu korrelieren. Zusätzlich sollten Analysen die Rolle anderer Nährstoffe berücksichtigen, denn die Gesundheitswirkung eines Fetts hängt oft vom gesamten Nährstoffkontext ab (z. B. Ersatz von gesättigten durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren vs. Ersatz durch Kohlenhydrate).
Für die Lebensmittelindustrie und Produktentwicklung ist die Erkenntnis relevant: Interestifizierung kann ein Werkzeug sein, um technologische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Bildung von Transfetten zu vermeiden. Allerdings sollten Reformulierungsentscheidungen stets auch epidemiologische Evidenz, lebensmitteltechnische Aspekte und Verbraucherakzeptanz berücksichtigen.
Für Verbraucher bedeutet die Studie nicht, dass verarbeitete Fette generell unbedenklich sind, sondern dass eine differenzierte Bewertung notwendig ist. Empfehlungen zur Reduktion des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben weiterhin: eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen, Gemüse und Obst, begrenztem Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Transfetten sowie regelmäßige körperliche Aktivität.
Abschließend liefern die Ergebnisse wichtige Einsichten für Ernährungsempfehlungen, Lebensmittelreformulierung und Verbraucherentscheidungen: Interestifizierte Fette, die reich an Palmitin- oder Stearinsäure sind und in realistischen Mengen konsumiert werden, erhöhten in dieser kontrollierten Kurzzeitstudie nicht die gängigen Marker des kardiovaskulären Risikos. Diese Nuance ist relevant für die Gestaltung evidenzbasierter Richtlinien und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit.
Quelle: scitechdaily

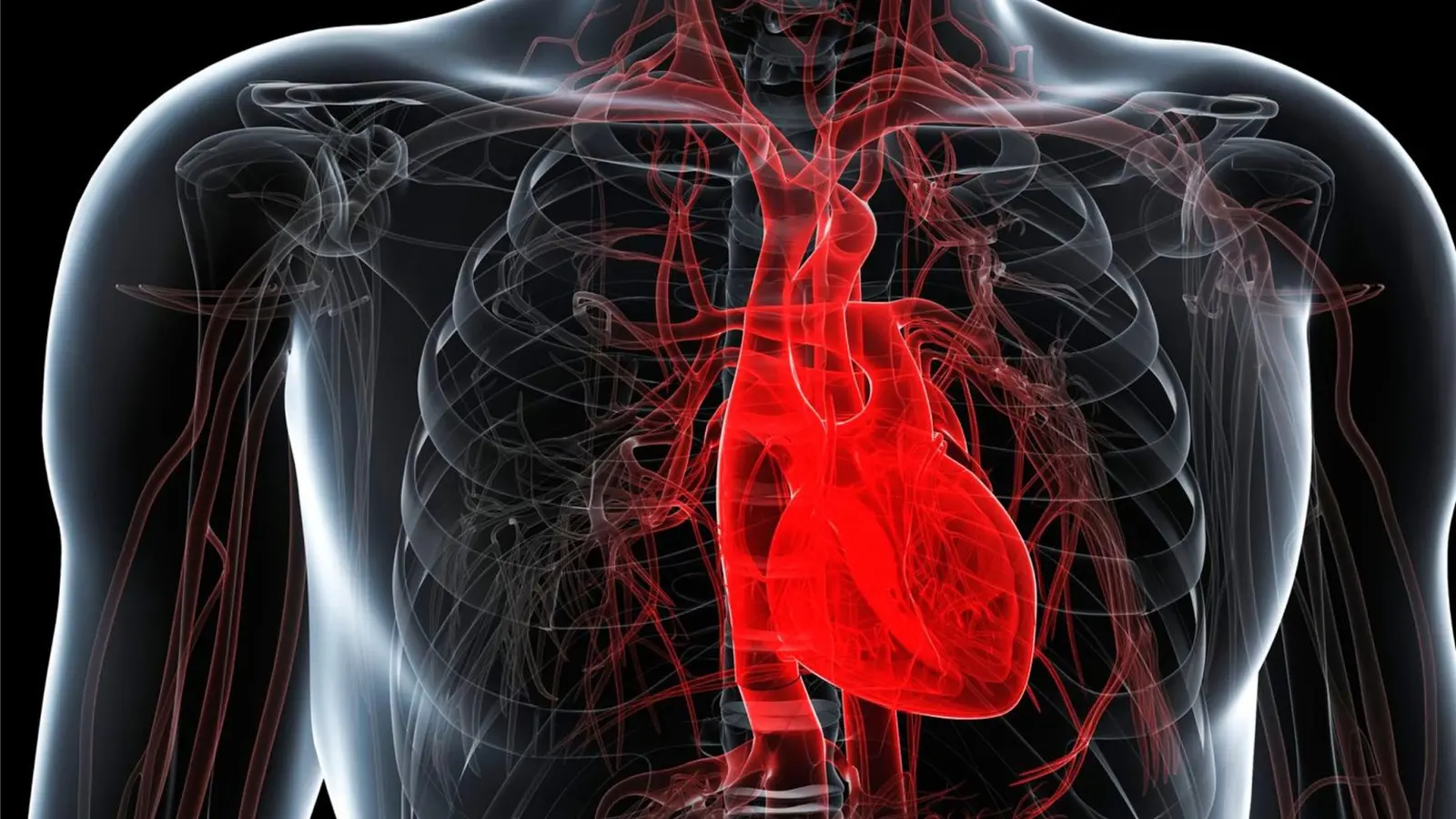
Kommentar hinterlassen