7 Minuten
Neue Hinweise deuten auf die äußeren Abwehrmechanismen des Gehirns hin
Jüngste Forschungsergebnisse der Gladstone Institutes und der UCSF rücken unsere Auffassung vom Risiko neurodegenerativer Erkrankungen in ein neues Licht. Anstatt ausschließlich in Neuronen ihren Ursprung zu haben, scheinen genetische Risikofaktoren für Erkrankungen wie Alzheimer und Schlaganfall prominent in den spezialisierten Zellen zu wirken, die die äußere Grenze des Gehirns bilden: Gefäßzellen und Immunzellen, die die Blut-Hirn-Schranke zusammensetzen. Diese neue Perspektive, veröffentlicht in Neuron, legt nahe, dass Verwundbarkeiten an der Schutzschnittstelle des Gehirns Krankheitsprozesse initiieren oder verstärken können.
Wissenschaftlicher Hintergrund: die Blut-Hirn-Schranke und regulatorische DNA
Das Gehirn ist auf mehr angewiesen als nur neuronale Netzwerke, um seine Funktion zu erhalten. Blutgefäße, perivaskuläre Stützszellen und Immunzellen arbeiten zusammen und bilden die Blut-Hirn-Schranke, eine selektive Schnittstelle, die Nährstofftransport steuert, Stoffwechselabfälle entfernt und Krankheitserreger sowie Toxine abwehrt. Jahrzehntelang haben genomweite Assoziationsstudien (GWAS) viele DNA-Varianten mit neurodegenerativen und zerebrovaskulären Erkrankungen verknüpft. Mehr als 90 % dieser Varianten liegen jedoch außerhalb protein‑kodierender Sequenzen, in regulatorischen Regionen, die früher oft als „nichtkodierend“ oder „Junk“-DNA bezeichnet wurden. Diese Regionen regulieren, wann und wo Gene aktiv sind — eher wie Dimmer als wie einfache Ein/Aus-Schalter — doch bislang fehlte eine detaillierte Karte, die diese Schalter bestimmten Zelltypen und Genen im Gehirn zuordnet.
Methoden: MultiVINE-seq und Single‑Cell Multi‑Omics
Um technische Hürden bei der Untersuchung von Gefäß- und Immunzellen aus menschlichem Hirngewebe zu überwinden, entwickelte das Gladstone-Team MultiVINE-seq, ein Protokoll, das Gefäß- und Immunzellen schonend aus postmortalen Proben isoliert und gleichzeitig sowohl Genexpressions- als auch Chromatin‑Zugänglichkeitsdaten erhält. Die Chromatin‑Zugänglichkeit zeigt, welche upstream-Regulationsregionen offen sind und wahrscheinlich die Genaktivität beeinflussen. Durch die Kombination von Transkriptomdaten mit Chromatin‑Karten auf Einzelzellebene über 30 menschliche Hirnproben hinweg erstellten die Forschenden einen hochauflösenden Atlas zelltypspezifischer Genregulation an der Blut-Hirn-Schranke.
Integration genetischen Risikos mit zellulären Daten
Die Erstautorinnen und -autoren integrierten den MultiVINE-seq‑Atlas mit umfangreichen GWAS-Daten zu Alzheimer, Schlaganfall und anderen neurologischen Erkrankungen. Dieser Ansatz ermöglichte es, die Aktivität krankheitsassoziierter genetischer Varianten präzise auf bestimmte Zelltypen zu lokalisieren. Auffällig war, dass viele Varianten, die zuvor als neuronenspezifisch angesehen wurden, funktionale Signaturen in Gefäß- und Immunzellen an den Grenzen des Gehirns zeigten.
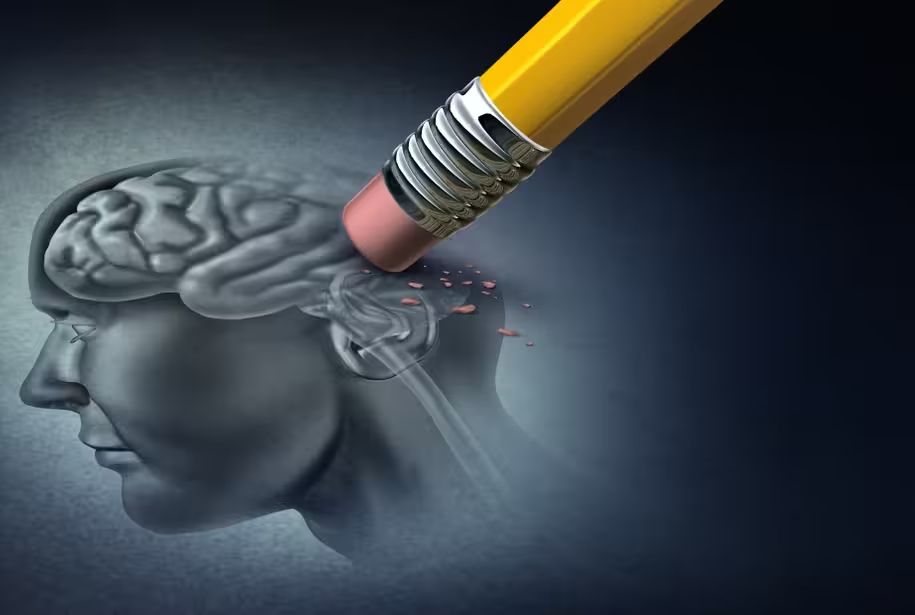
Wesentliche Entdeckungen: unterschiedliche Mechanismen bei Schlaganfall und Alzheimer
Die Studie zeigt, dass krankheitsassoziierte Varianten nicht überall in den Barriereszellen gleich wirken. Genetische Treiber, die mit Schlaganfällen in Verbindung stehen, beeinflussen bevorzugt Gene, die an der strukturellen Integrität von Blutgefäßen beteiligt sind. Diese Varianten liegen häufig in Chromatinregionen, die Gene steuern, welche die Stabilität und Architektur von Gefäßen aufrechterhalten — passend zu einem Modell, in dem genetisches Risiko die Anfälligkeit für Gefäßschwäche und Ruptur erhöht.
Im Gegensatz dazu waren Alzheimer-assoziierte Varianten in regulatorischen Regionen angereichert, die in Immunzellen, insbesondere in T‑Zellen, aktiv sind, sowie in vaskulären Immun‑Signalwegen. Anstatt die Gefäßstruktur zu schwächen, scheinen die mit Alzheimer verknüpften Varianten die Immunaktivität an der Blut-Hirn-Schranke zu verstärken, was übermäßige Entzündungsreaktionen und das Eindringen von Immunzellen ins Gehirn fördern könnte. Das deutet auf grundlegend unterschiedliche frühere Mechanismen hin: strukturelle Verwundbarkeit beim Schlaganfall versus dysregulierte Immunantworten bei Alzheimer.
PTK2B tritt als Immunverstärker im Zusammenhang mit Alzheimer hervor
Unter den Alzheimer-assoziierten Loci stach eine häufige Variante in der Nähe von PTK2B hervor. Diese Variante, die bei mehr als einem Drittel der Menschen vorkommt, zeigt starke regulatorische Aktivität in T‑Zellen und korreliert mit einer erhöhten PTK2B‑Expression. PTK2B wird mit T‑Zell‑Aktivierung und -Migration in Verbindung gebracht; eine gesteigerte Expression könnte das Eindringen von Immunzellen ins Gehirn fördern und lokale Entzündungen erhöhen. Die Autorinnen und Autoren beobachteten PTK2B‑reiche Immunzellen in der Nähe von Amyloid‑Plaques, den Proteinaggregaten, die für die Alzheimer‑Pathologie charakteristisch sind.
Entscheidend ist, dass PTK2B als „druggable“ Ziel gilt und Inhibitoren bereits in onkologischen Studien getestet werden. Die neuen Befunde eröffnen die Möglichkeit, PTK2B-modulierende Arzneimittel umzunutzen oder neue Therapien zu entwickeln, die die Immunaktivierung an der Barriere dämpfen — eine Strategie zur Prävention oder Behandlung von Alzheimer.
Folgen für Therapie, Prävention und Forschungsprioritäten
Indem die Studie Gefäß- und Immunzellen an der Gehirnschnittstelle in den Fokus rückt, öffnet sie mehrere translationale Chancen. Erstens sind Barriereszellen für systemisch verabreichte Therapien leichter zugänglich als Neuronen hinter der Blut-Hirn-Schranke, was die Wirkstoffzufuhr vereinfachen könnte. Zweitens, da diese Zellen zirkulierenden Faktoren ausgesetzt sind, können Lebensstil und Umweltfaktoren mit genetischem Risiko an der Barriere interagieren; das spricht für neue Präventionsstrategien, die Verhaltensmaßnahmen mit gezielten Therapeutika kombinieren.
Schließlich stellen der Multi‑Omics‑Atlas und die MultiVINE-seq‑Methode eine wertvolle Ressource für das Feld dar, da sie Forschenden ermöglichen, weitere krankheitsassoziierte regulatorische Varianten auf bestimmte Zelltypen und Signalwege zuzuordnen. Dieser zellauflösende Ansatz dürfte die Identifizierung praktikabler Ziele beschleunigen und Krankheitsmodelle verfeinern, die nicht-neuronale Treiber der Neurodegeneration und zerebrovaskulären Erkrankungen einbeziehen.
Experteneinschätzung
Dr. Lena Hoffman, eine fiktive Neuroimmunologin und Wissenschaftskommunikatorin, kommentiert: "Diese Arbeit ist ein Paradigmenwechsel. Zu lange haben wir uns auf neuronzentrierte Modelle der Neurodegeneration konzentriert. Die Kartierung regulatorischer DNA‑Aktivität in Gefäß- und Immunzellen zeigt, dass die Schnittstelle des Gehirns zum Körper ein aktiver Mitspieler beim Krankheitsrisiko ist. Das hat praktische Konsequenzen: Barriereszellen sind durch blutgetragene Medikamente erreichbar und reagieren auf Lebensstil‑Expositionen, sodass wir mehr Ansatzpunkte zur Risikoänderung haben als bisher angenommen."
Dr. Hoffman fügt hinzu: "Die Entdeckung, dass PTK2B‑Varianten die T‑Zell‑Signalgebung in der Nähe von Amyloidablagerungen verstärken, ist besonders interessant, weil sie häufige genetische Variation, Immunaktivierung und pathologische Merkmale von Alzheimer verbindet. Bestätigen Folgeuntersuchungen eine kausale Rolle, könnten Studien zur Wirkstoffumwidmung relativ schnell in klinische Prüfungen übergehen."
Nächste Schritte und zukünftige Richtungen
Wichtige nächste Schritte umfassen die Validierung kausaler Zusammenhänge zwischen spezifischen regulatorischen Varianten, verändertem Zellverhalten an der Blut-Hirn-Schranke und dem klinischen Krankheitsverlauf. Längsschnittstudien am Menschen, experimentelle Modelle, die Barrierezell‑Interaktionen nachbilden, sowie klinische Studien, die PTK2B‑Inhibitoren oder andere Modulatoren der Barrier‑Immunaktivität testen, werden erforderlich sein. Darüber hinaus wird die Erweiterung der MultiVINE-seq‑Datensätze auf vielfältigere Populationen und Krankheitsstadien helfen zu klären, wie universell diese Mechanismen über Alter, Abstammung und Umweltbedingungen hinweg sind.
Fazit
Diese Multi‑Omics‑Studie stellt das genetische Risiko für Alzheimer und Schlaganfall neu dar, indem sie zentrale funktionelle Effekte in den Zellen lokalisiert, die die äußere Abwehr des Gehirns bilden. Gefäß- und Immunzellen an der Blut-Hirn-Schranke werden damit nicht mehr nur als sekundäre Opfer neuronalen Abbaus gesehen, sondern als primäre Orte, an denen genetische Varianten das Krankheitsrisiko erhöhen. Unterschiedliche Mechanismen — strukturelle Schwächung beim Schlaganfall und verstärkte Immunsignalgebung bei Alzheimer — deuten auf spezifische Strategien für Prävention und Therapie hin. Die Studie stellt zudem ein neues experimentelles Werkzeug und einen zellauflösenden Atlas bereit, die zukünftige Forschung und die Entwicklung therapeutischer Ansätze leiten und die Barrierebiologie ins Zentrum der Neurodegenerationsforschung rücken.
Quelle: scitechdaily

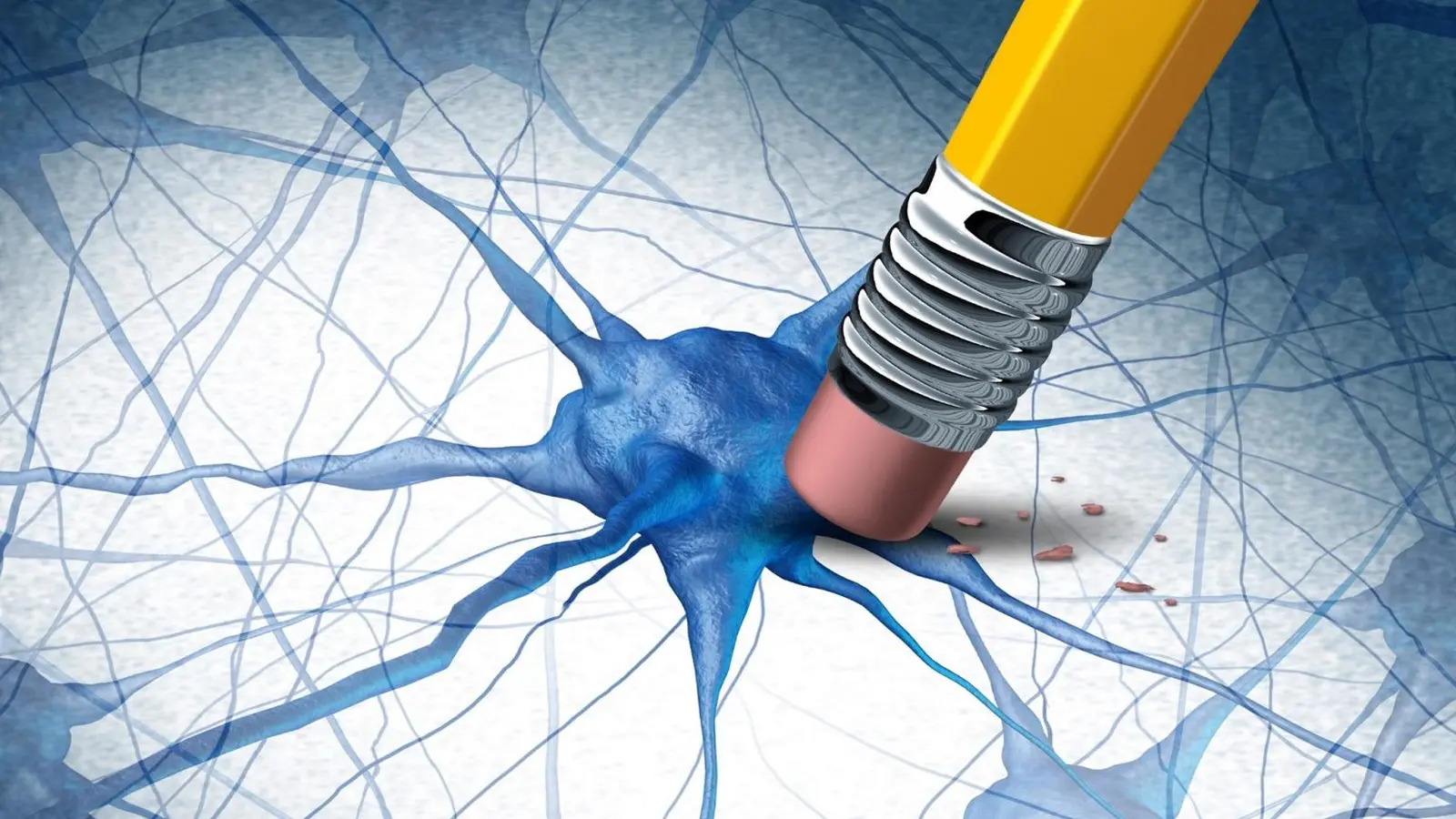
Kommentar hinterlassen