10 Minuten
Neue, robuste Forschung zeigt: Meeres‑Hitzewellen können die biologische Kohlenstoffpumpe des Ozeans stören – das System, das Kohlenstoff von der Oberfläche in die Tiefsee transportiert. Ein interdisziplinäres Team unter Leitung des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) hat autonome Messbojen und langjährige Schiffsdaten im Golf von Alaska kombiniert, um zu untersuchen, wie zwei große Hitzewellen Planktongemeinschaften veränderten und wohin Kohlenstoffpartikel in der Wassersäule transportiert wurden.

Roboter‑Messbojen liefern kontinuierlich hochauflösende Daten zu Ozeanzuständen. Die neue Studie, geleitet von MBARI-Forschern aus dem Global Ocean Biogeochemistry (GO-BGC) Array‑Projekt, wertete Daten aus Argo‑BGC‑Floats im Golf von Alaska sowie Proben aus Schiffs‑Planktonerhebungen aus. Ergebnis: Meeres‑Hitzewellen verändern Nahrungsnetze und beeinflussen maßgeblich, wie effizient der Ozean atmosphärisches CO2 langfristig binden kann.
Warum die biologische Kohlenstoffpumpe so wichtig ist
Der Ozean ist einer der größten Kohlenstoffsenken der Erde: Etwa ein Viertel der vom Menschen verursachten CO2‑Emissionen wird vom Meer aufgenommen. Eine zentrale Rolle für die langfristige Speicherung spielt die biologische Kohlenstoffpumpe. Phytoplankton – mikroskopisch kleine, fotosynthetisch aktive Organismen – wandeln CO2 in organische Substanz um, die dann durch das Nahrungsnetz weitergereicht wird. Sobald Konsumenten Fäkalpellets produzieren oder Phytoplankton‑Aggregationen bilden, sinken diese Partikel durch die Mesopelagialzone (etwa 200–1.000 m) in die Tiefsee, wo Kohlenstoff oft jahrhundertelang bis Jahrtausende gespeichert bleibt.
Meeres‑Hitzewellen sind ungewöhnlich warme Meeresbedingungen, die Tage bis Monate anhalten können. Solche Ereignisse beeinflussen Artenzusammensetzung, Stoffwechselraten und trophische Wechselwirkungen. Das kann die Größe, Dichte und Sinkgeschwindigkeit von Partikeln verändern, oder die Verweildauer organischer Substanz in oberflächennahen Schichten erhöhen – beides reduziert den Export von organischem Kohlenstoff in die Tiefe. Um diese Prozesse zu verstehen, braucht es wiederholte, hochfrequente biologische und chemische Messungen von der Oberfläche bis in große Tiefen, vor, während und nach den Hitzewellen.
Methodik: Wie das Team Daten zusammenführte
Die Untersuchung integrierte mehrere unabhängige Datensätze über mehr als ein Jahrzehnt aus dem Golf von Alaska, einer Region, die zwei bedeutende Meeres‑Hitzewellen erlebte: die 2013–2015‑Ereignisserie, bekannt als »The Blob«, und ein starkes Ereignis 2019–2020. Entscheidende Beobachtungsinstrumente und Datensätze umfassten:
- GO‑BGC BGC‑Argo‑Floats: Im Rahmen des Global Ocean Biogeochemistry (GO‑BGC) Array wurden autonome Floats eingesetzt, die Temperatur, Salinität, Sauerstoff, Nitrat, Chlorophyll‑Fluoreszenz und partikulären organischen Kohlenstoff (POC) alle 5–10 Tage im oberen Wasserprofil messen. Diese kontinuierliche Abtastung liefert wiederholte, hochfrequente Profile biologischer und chemischer Zustände über Jahreszeiten und Störungen hinweg.
- Line P Schiffsbeobachtungen: Das langjährige Programm Line P von Fisheries and Oceans Canada lieferte saisonale Daten zur Planktongemeinschaft mittels Pigmentanalytik und Umwelt‑DNA (eDNA)‑Sequenzierung. Schiffsbasierte Stichproben bieten taxonomische Details und validieren Signale, die aus Floats abgeleitet werden.
- Interdisziplinäre Synthese: Das Team vereinte Expertise aus MBARI, der University of Miami Rosenstiel School, dem Hakai Institute, der Xiamen University, der University of British Columbia, der University of Southern Denmark und Fisheries and Oceans Canada. Ozeanographie, Molekularbiologie, Biogeochemie und Ökosystemforschung wurden kombiniert, um Mechanismen und Auswirkungen zu deuten.
Technische Hintergründe der Messsysteme
BGC‑Argo‑Floats sind mit Sensorsystemen ausgestattet, die physikalische und biogeochemische Parameter messen und via Satellit übertragen. Ihre Stärke liegt in der Lückenfüller‑Funktion: Sie liefern kontinuierliche Zeitreihen auch in rauer See oder fernab von Schifffahrtsrouten. Ergänzt durch Schiffsproben mit höherer taxonomischer Auflösung (z. B. eDNA) und Laboranalysen (Pigmente, Partikelgrößenverteilung), entsteht ein umfassenderes Bild über Struktur und Funktion planktonischer Gemeinschaften.
Ergebnisse: Wann das Förderband klemmt
Die Auswertung ergab konsistente Hinweise darauf, dass Meeres‑Hitzewellen die Planktongemeinschaften veränderten und den Kohlenstoffexport störten. Interessanterweise wirkten die beiden Hitzewellen auf unterschiedliche Weise mechanisch:
- 2013–2015 (»The Blob«): In der zweiten Hitzewellen‑Saison nahm die Oberflächenproduktion durch photosynthetisches Plankton zu. Dennoch sammelte sich partieller organischer Kohlenstoff vornehmlich um etwa 200 m an, anstatt schnell in die Tiefsee zu sinken. Dieses Muster deutet auf ein Engpass‑Phänomen in der Mesopelagialzone hin, bei dem kleine Partikel und rekylierter Kohlenstoff zurückgehalten wurden, statt langfristig sequestriert zu werden.
- 2019–2020: Im ersten Jahr dieses Ereignisses registrierten die Messungen eine Rekordzunahme oberflächennaher Kohlenstoffpartikel, die sich nicht allein durch gesteigerte Phytoplanktonproduktion erklären ließen. Vielmehr scheint ein verstärkter Recyclingprozess innerhalb des Nahrungsnetzes und ein Aufbau von Detritus die Ursache. Diese Materialpulsen begannen zu sinken, blieben jedoch größtenteils in der 200–400 m‑Zone hängen und erreichten nicht effizient den Tiefseespeicher.
Über beide Episoden hinweg war ein gemeinsamer Trend erkennbar: erhöhte Retention und biologisches Recycling organischen Kohlenstoffs in Oberflächen‑ und Dämmerungszonen. Getrieben wurde dies durch eine Verschiebung hin zu kleineren Phytoplankton‑Taxa und einer höheren Dichte kleinerer Weidetiere. Kleine Fraßorganismen produzieren langsam sinkende Fäkalpellets und fördern mikrobielle Zersetzung — Prozesse, die Kohlenstoff nahe der Oberfläche halten und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er wieder in die Atmosphäre gelangt.
»Unsere Forschung hat gezeigt, dass diese beiden großen Meeres‑Hitzewellen Planktongemeinschaften veränderten und die biologische Kohlenstoffpumpe störten – das Förderband, das Kohlenstoff von der Oberfläche in die Tiefsee transportiert, klemmt«, erklärt Hauptautorin Mariana Bif, ehemals MBARI, jetzt Assistant Professor an der University of Miami Rosenstiel School. »Das erhöht das Risiko, dass Kohlenstoff in die Atmosphäre zurückkehrt, statt in der Tiefsee ‚abgelegt‘ zu werden.«
Welche Belege stützen diese Schlüsse?
Mehrere unabhängige Indikatoren bestätigten die Interpretation: erhöhte POC‑Profile in bestimmten Tiefen, Veränderte Chlorophyll‑Fluoreszenz‑Signale, eDNA‑daten, die einen Anstieg kleiner phytoplanktischer Taxa zeigten, und veränderte Partikelgrößenverteilungen in Schiffsproben. Kombiniert liefern diese Messgrößen ein schlüssiges Bild, das einfache zufällige Schwankungen unwahrscheinlich macht.
Mechanismen im Detail: Artenwandel, Partikelgröße und Mesopelagiale Verarbeitung
Die biologischen Mechanismen, die Wärmeeinträge mit Kohlenstoffretention verbinden, umfassen mehrere ineinandergreifende Prozesse:
- Artenturnover: Wärmere Bedingungen begünstigen kleinere, wärmegewohnte Phytoplankton‑Linien, die feine, langsam sinkende Partikel produzieren statt großer Aggregationen.
- Umschaltung des Nahrungsnetzes: Zunehmende Häufigkeit kleiner Weidetiere führt zu stärkerem Recycling; Mikroben atmen organischen Kohlenstoff zu CO2 um, bevor dieser tiefer sinken kann.
- Mesopelagiale Verarbeitung: Die Dämmerungszone ist reich an Organismen, die sinkende Partikel konsumieren; eine geringere Sinkrate erhöht die Verweilzeit und damit die Chance, dass Partikel remineralisiert werden.
Diese Prozesse verringern zusammen den Anteil des an der Oberfläche produzierten organischen Kohlenstoffs, der die Tiefsee erreicht, und schwächen so die langfristige Kohlenstoffsenke des Ozeans.
Folgen für Klima, Ökosysteme und Fischerei
Steigen Häufigkeit und Ausdehnung von Meeres‑Hitzewellen – wie Klimamodelle und Beobachtungen erwarten lassen – könnte die Effektivität des Ozeans als Kohlenstoffsenke abnehmen. Eine weniger effiziente Sequestrierung erzeugt eine positive Rückkopplung: Mehr CO2 verbleibt in der Atmosphäre, beschleunigt die Erwärmung und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Hitzewellen.
Ökologisch gesehen wirken Veränderungen an der Planktonbasis stark durch: weniger stabile Nahrungsgrundlagen können die Rekrutierung von Fischen, das Futterangebot für Meeressäuger und somit die Produktivität ganzer Fischregionen beeinträchtigen. Regionale Wirtschaften, die von stabilen Fangmengen abhängen, könnten eine höhere Volatilität und Ernährungsunsicherheit erleben, wenn sich die Beutegrundlage zu kleineren, weniger energiereichen Organismen verschiebt.
Gibt es bereits beobachtbare wirtschaftliche Effekte?
In einigen betroffenen Regionen gab es bereits Hinweise auf veränderte Fischbestände und Wanderungsmuster, doch direkte wirtschaftliche Verknüpfungen sind komplex: Zeitverzögerungen im Ökosystem, Überlappungen mit Fischereimanagement und andere Stressoren (Überfischung, Verschmutzung) erschweren einfache Attributionen. Dennoch lohnt es sich, die potenziellen sozioökonomischen Folgen in Anpassungsstrategien einzubeziehen.
Technologie, Monitoring und nächste Forschungsfragen
Die Studie zeigt den Wert der Kombination autonomer BGC‑Argo‑Floats mit schiffsbasierter Biologie und molekularen Werkzeugen (eDNA, Pigmentchemie). Wichtige Prioritäten für zukünftige Forschung und Monitoring lauten:
- Ausbau der BGC‑Argo‑Float‑Abdeckung, um unterschiedliche Ozeanregime und Hitzewellenereignisse zu erfassen.
- Integrierte, institutionenübergreifende Beobachtungsnetzwerke, die Vor‑, Während‑ und Nach‑Baseline für Extremereignisse liefern.
- Verbesserte biogeochemische und Ökosystem‑Modelle, die planktonische Gemeinschaftsverschiebungen, Partikelbildung und mesopelagiale Verarbeitung realistisch abbilden können, um Kohlenstoffexport unter Erwärmungsszenarien besser vorherzusagen.
Ken Johnson, MBARI Senior Scientist und Hauptverantwortlicher des GO‑BGC‑Projekts, betonte den kollaborativen Ansatz: »Um wirklich zu verstehen, wie eine Hitzewelle marine Ökosysteme und ozeanische Prozesse beeinflusst, brauchen wir Beobachtungsdaten von vor, während und nach dem Ereignis. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Zusammenarbeit zentrale Fragen zur Gesundheit des Ozeans beantworten kann.«
Welche Modellverbesserungen sind nötig?
Für Modellierer ist es wichtig, variable Partikelgrößen‑Dynamiken, Fraßpfade und mikrobielle Remineralisierung genauer zu integrieren. Momentane Modelle neigen dazu, Partikelprozesse zu vereinfachen; das erhöht Unsicherheit in Prognosen zur Kohlenstoffbindung. Detaillierte Parameterisierungen, unterstützt durch beobachtungsbasierte Zeitreihen, können Prognosekraft und Policy‑Relevanz erheblich verbessern.
Fachliche Einschätzungen und praktische Tipps für Beobachter
Fiktive Expertin Dr. Lena Morita, Ozean‑Biogeochemikerin, kommentierte: »Die Studie ist ein deutliches Signal, dass biologische Reaktionen auf Erwärmung das Schicksal von Kohlenstoff über Dekaden verändern können. Autonome Floats geben uns die zeitliche Auflösung, um diese Reaktionen in Echtzeit zu beobachten. Für Modellierer ist es entscheidend, dynamische Partikelgrößen und Fraßwege zu integrieren, um Unsicherheiten in Klimavorhersagen zu reduzieren.«
Für Beobachter und Behörden bedeuten die Ergebnisse: Priorität auf kontinuierliche Messreihen legen, Plattformen vernetzen und Datentransparenz fördern, damit schnelle, evidenzbasierte Managemententscheidungen möglich sind.
Finanzierung, Zusammenarbeit und globale Bedeutung
Die Forschung wurde hauptsächlich durch das US National Science Foundation GO‑BGC Projekt (NSF Award 1946578 mit operativer Unterstützung durch NSF Award 2110258) gefördert. Weitere Beiträge kamen von der David and Lucile Packard Foundation, der China National Science Foundation (Grant 42406099), den Fundamental Research Funds for the Central Universities (Grant 20720240105), dem Danish Center for Hadal Research (DNRF145) und dem Line P Programm von Fisheries and Oceans Canada. Die interdisziplinäre Autorenschaft zeigt, wie koordinierte internationale Investitionen in dauerhafte Ozeanbeobachtung wissenschaftlich sehr wertvolle Erkenntnisse liefern.
Die globale Relevanz dieser Arbeit ist groß: Während lokale Prozesse variieren, können ähnliche Mechanismen in vielen Ozeanregionen wirken, wenn Hitzewellen die Struktur planktonischer Gemeinschaften umformen. Deshalb sind internationale Beobachtungsnetzwerke und standardisierte Methoden zentral für vergleichbare, politikrelevante Erkenntnisse.
Das Zusammenspiel von Technologie (BGC‑Argo), traditionellen Schiffsprogrammen (Line P) und molekularen Methoden (eDNA) bietet ein Vorbild für zukünftige Monitoring‑Programme weltweit. Gemeinsam ermöglichen sie, Hitzewellen als Naturereignisse in Echtzeit zu verfolgen und ihre weitreichenden Folgen für Kohlenstoffzyklen und Ökosystemfunktionen zu quantifizieren.
Auf politischer Ebene unterstreicht die Studie die Notwendigkeit, Klimapolitik mit Meeresschutzmaßnahmen zu verknüpfen: Reduzierte Emissionen und Resilienzförderung in marinen Schutzgebieten können zusammen dazu beitragen, das Risiko künftiger Störungen zu mindern.
So zeigt diese Arbeit eindrücklich: Der Ozean ist kein statischer Puffer. Seine Fähigkeit, CO2 zu speichern, ist dynamisch und anfällig für systemische Veränderungen. Eine umfassende, vernetzte Beobachtung ist daher keine akademische Luxusfrage, sondern eine Schlüsselvoraussetzung, um die Rolle des Ozeans im Erdsystem in einer sich erwärmenden Welt zu verstehen und zu schützen.
Quelle: sciencedaily

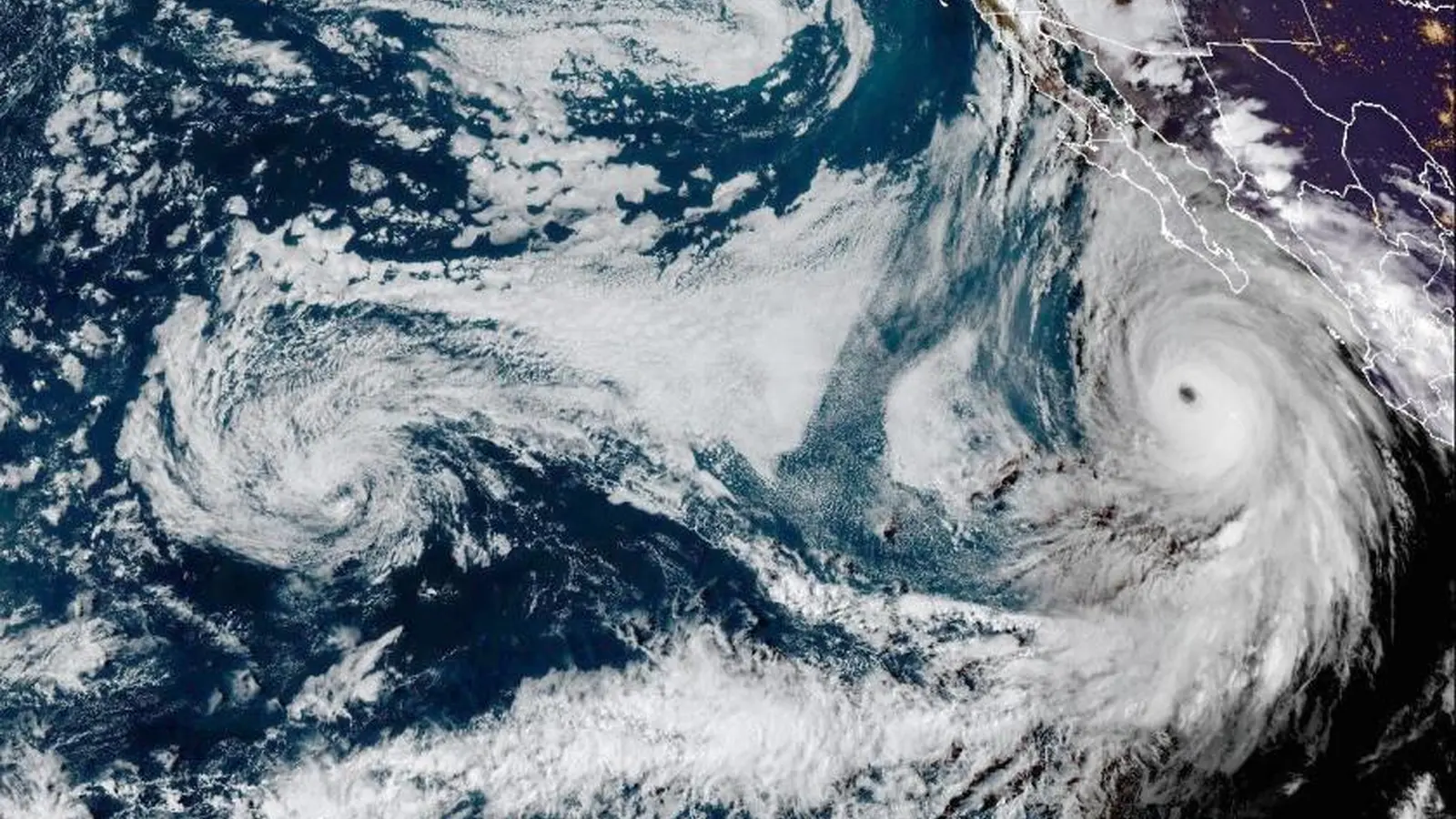
Kommentar hinterlassen