6 Minuten
Introduction: A measurable signal for long COVID?
Forscher des Translational Genomics Research Institute (TGen) an der City of Hope und des Lundquist Institute for Biomedical Innovation am Harbor-UCLA berichten, dass sie Fragmente von SARS‑CoV‑2‑Proteinen innerhalb von Extrazellulären Vesikeln (EVs) im Blut von Menschen mit Long‑COVID nachgewiesen haben. Diese ‚Geisterpeptide‘ – molekulare Überreste viraler Proteine – könnten das erste zirkulierende Biomarkerzeichen für Post‑Acute Sequelae of SARS‑CoV‑2 infection (PASC), allgemein bekannt als Long COVID, darstellen. Sollte dieser Befund unabhängig bestätigt werden, wäre das ein wichtiger Fortschritt für die Diagnostik und die Erforschung einer Erkrankung, die derzeit überwiegend anhand von patientenberichteten Symptomen definiert wird.
Discovery and experimental approach
What the team looked for
Die Forschenden untersuchten 56 Serumproben von 14 Teilnehmenden, die an einer 12‑wöchigen klinischen Studie zu aerobem Training eingeschrieben waren. Mithilfe hochsensitiver Massenspektrometrie und gezielter Proteomik isolierten sie extrazelluläre Vesikel – nanoskalige lipidhaltige Pakete, die Zellen freisetzen, um Proteine, RNA und Stoffwechselprodukte zu transportieren – und durchsuchten diese gezielt nach SARS‑CoV‑2‑verwandten Peptiden.
Key molecular finding
In den Proben identifizierten die Forschenden insgesamt 65 verschiedene Peptidfragmente, die vom pp1ab‑Polyprotein des Virus abstammen, einem für die RNA‑Replikation von SARS‑CoV‑2 essenziellen Enzymkomplex. Die pp1ab‑Sequenz ist virusspezifisch und kommt nicht in gesunden menschlichen Zellen vor, wodurch diese Peptide als plausible virale Signaturen gelten. Die Fragmente traten in EVs aller Studienteilnehmer zu bestimmten Zeitpunkten auf, jedoch nicht in jeder einzelnen Blutabnahme, und waren in EV‑Proben aus der Zeit vor der Pandemie nicht nachweisbar.
Scientific context: EVs, proteomics and viral reservoirs
Why extracellular vesicles matter
Extrazelluläre Vesikel gewinnen zunehmend an Bedeutung als Vermittler interzellulärer Kommunikation und als Träger krankheitsrelevanter Biomarker. Da EVs Gewebsbarrieren überwinden und molekularen Frachtgut über weite Strecken transportieren können, bieten sie einen denkbaren Mechanismus dafür, wie virales Material aus lokalisierten Reservoirs ins periphere Blut gelangen könnte, ohne dass konventionelle, intakte Viruspartikel nachgewiesen werden.

How this fits with the viral persistence hypothesis
Wachsende Evidenz deutet darauf hin, dass SARS‑CoV‑2‑RNA und -Proteine noch Monate nach der akuten Infektion in Geweben verbleiben können. Manche Forschende vermuten, dass solche verbliebenen viralen Reservoirs – etwa im Darm, in Nervengewebe oder in lymphatischen Kompartimenten – zeitweise virale Komponenten freisetzen könnten, die Immunreaktionen auslösen und chronische Symptome antreiben. Der Nachweis von pp1ab‑abgeleiteten Peptiden in zirkulierenden EVs stützt diese Hypothese, beweist jedoch nicht zwingend aktive Virusreplikation.
Interpretation, limitations and next steps
Das vom Team gemessene Signal war subtil und nur zeitweise nachweisbar. Wie Patrick Pirrotte, Ph.D., Mitautor, betont, ‚gibt es noch vieles, das wir derzeit nicht verstehen.‘ Zentrale offene Fragen sind, ob die Peptide anhaltende Low‑Level‑Replikation widerspiegeln, episodisches Abschuppen aus einem Gewebereservoir bedeuten oder schlicht das Ergebnis zellulärer Prozesse sind, bei denen nach der ursprünglichen Infektion Proteinfragmente abgebaut und exportiert werden – also sozusagen ‚molekularer Müll‘.
Weitere methodische und interpretative Einschränkungen bestehen: Es gab keine passenden Kontrollpersonen in der Studie, die COVID‑19 überwunden hatten, aber keine Langzeitsymptome entwickelten, und das beobachtete Peptidprofil enthielt nicht die sonst typischerweise mit aktiver Replikation assoziierten größeren Struktur‑ oder Nichtstrukturproteine. Zudem lässt sich noch nicht sagen, ob äußere Faktoren – etwa körperliche Belastung durch das Trainingsprotokoll oder immunologische Aktivierung – die Nachweiszeitpunkte beeinflussen. William Stringer, M.D., leitender Autor, fasste die klinische Situation zusammen: ‚Ich stelle Patient:innen aufgrund anhaltender Symptome eine Verdachtsdiagnose, aber es gibt keine Bluttests oder Biomarker, die diese Diagnose bestätigen.‘ Die Validierung eines reproduzierbaren Blutbiomarkers würde diese diagnostische Lage grundlegend verändern.
Implications for diagnostics and therapeutics
Wenn sich die Ergebnisse in größeren Kohorten mit adäquaten Kontrollen reproduzieren lassen, könnten EV‑assoziierte virale Peptide zu einem objektiven Labortest werden, der die Long‑COVID‑Diagnose stützt, die Forschung besser stratifiziert und möglicherweise gezielte Therapien lenkt. Nachweisbares virales Material könnte therapeutische Strategien auf das Eliminieren von Reservoirs oder auf die Modulation EV‑vermittelter Wege fokussieren. Proteomik und Massenspektrometrie werden dabei voraussichtlich zentrale Technologien sein, da sie sehr empfindlich niedrige Peptidmengen detektieren können, die Routineassays entgehen.
Expert Insight
Dr. Elena Moreno, eine hypothetische Infektionskrankheitenforscherin und wissenschaftliche Kommunikatorin mit Erfahrung in der Forschung zur viralen Persistenz, kommentiert: ‚Diese Studie liefert ein überzeugendes Proof‑of‑Concept. Virusspezifische Peptide in EVs zu finden, bietet einen plausiblen Weg, wie gewebsvermittelte Signale im Blut sichtbar werden können. Die klinische Nützlichkeit wird jedoch von Reproduzierbarkeit und Spezifität abhängen – können wir Long COVID von normaler postinfektiöser Proteinräumung unterscheiden? Große, kontrollierte Studien mit longitudinalen Probenahmen sind der nächste notwendige Schritt.‘ Dr. Moreno betont außerdem, dass die Integration von proteomischen Daten mit Gewebebiopsien, Immunprofilen und bildgebenden Verfahren entscheidend sein wird, um die biologische Grundlage dieser Signale zu kartieren.
Quotes from the research team
Asghar Abbasi, Ph.D., Erstautor, hob die Virus‑Spezifität der pp1ab‑Peptide hervor: 'This protein is unique to SARS‑CoV‑2 and does not exist in healthy human cells.' Dr. Abbasi unterstrich zudem die Begründung für die Untersuchung von EVs: 'We thought that maybe if the virus is circulating or moving in the body, we should try to see if EVs are carrying those viral fragments.'
Conclusion
Der Nachweis von SARS‑CoV‑2‑abgeleiteten Peptiden in zirkulierenden extrazellulären Vesikeln bietet einen vielversprechenden Ansatz für einen messbaren Biomarker bei Long COVID. Zwar deuten die Befunde darauf hin, dass persistentes virales Material über EVs verfolgt werden kann, doch zeigen sie bisher weder aktive Replikation noch einen kausalen Zusammenhang mit chronischen Symptomen. Zukünftige Arbeiten müssen diese Peptide in größeren, gut kontrollierten Kohorten validieren, ihre Gewebeherkunft und zeitliche Dynamik klären und prüfen, ob sie klinische Verläufe oder Therapieansprechen vorhersagen. Wird dies bestätigt, könnten EV‑assoziierte virale Peptide Diagnostik und Verständnis viraler Reservoirs revolutionieren und neue therapeutische Wege eröffnen, um die Langzeitfolgen von COVID‑19 zu behandeln.
Referenz: Abbasi A., Sharma R., Hansen N., Pirrotte P., Stringer W. W., 'Possible long COVID biomarker: identification of SARS‑CoV‑2 related protein(s) in Serum Extracellular Vesicles', Infection, 21 July 2025.
Quelle: scitechdaily

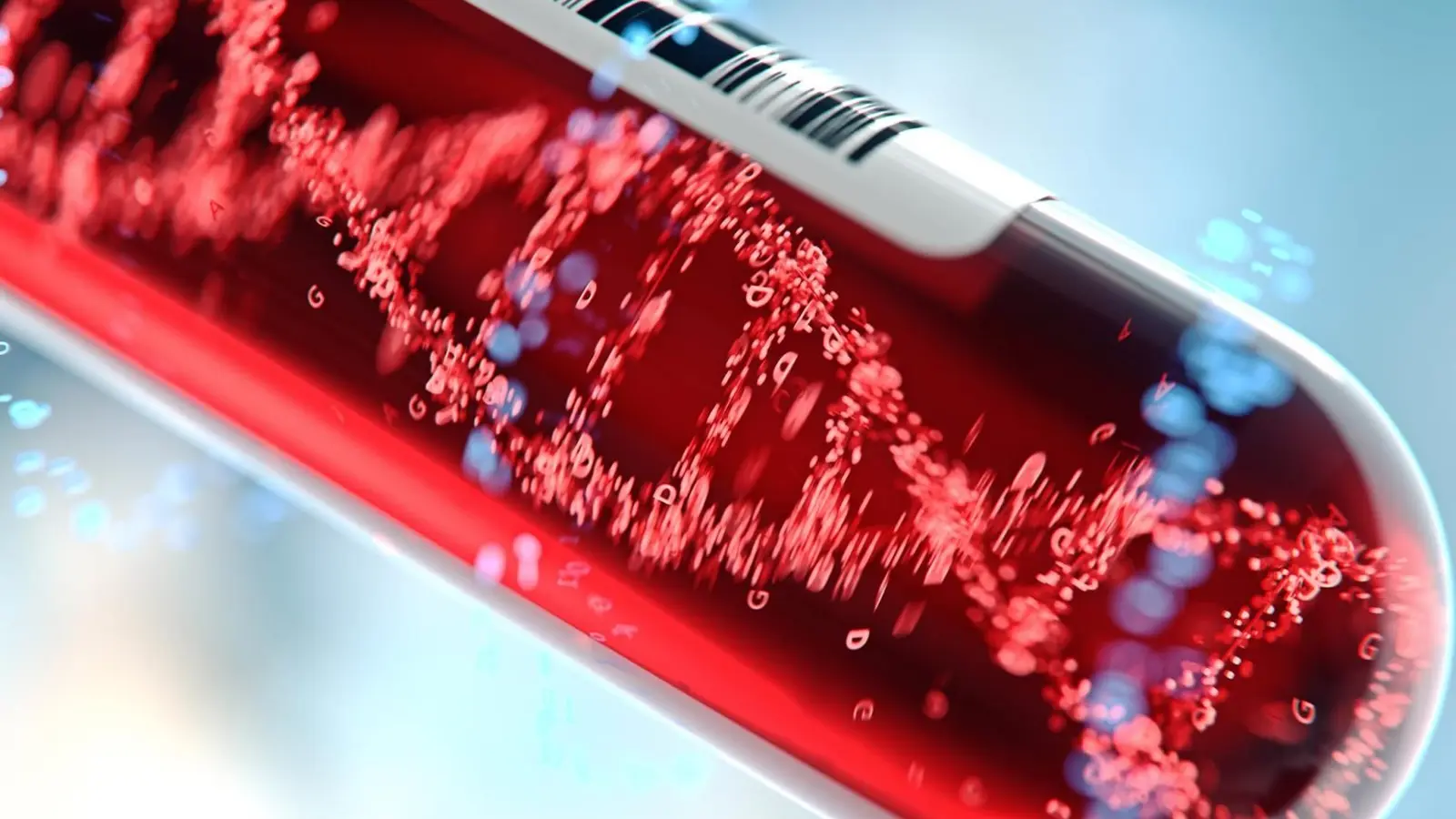
Kommentar hinterlassen